Superhelden
Es ist unübersehbar:
Superhelden haben neuerdings wieder Hochkonjunktur. Nach einer längeren Zeit der literarischen und filmischen Antihelden, welche neben dem Zerbruch ihrer Familie, ihrer Alkoholsucht und ihren Suizidplänen noch Verbrechen aufklärten, werden seit einigen Jahren wieder die übernatürlichen Fähigkeiten gefeiert.
Nicht nur hat die Comicschmiede »Marvel« ihre Heldinnen und Helden in einer Filmserie auf die Kinoleinwand gebracht, welche alle Einspielrekorde Hollywoods in den Schatten stellt (zum »Marvel Cinmatic Universe« gehören Iron Man, Thor, Hulk und andere Figuren, die sich zu den »Avengers« verbünden). Auch in der Welt der Serien auf Netflix, HBO, Disney und Co. überschlagen sich die Geschichten von Superhelden förmlich. Mit »Freaks« hat jetzt auch eine deutsche Filmcrew ihr eigenes Superhelden-Drama geschaffen.
Ob man es blutig-düster (»The Punisher«) oder lieber locker-jugendlich (»Supergirl«) mag, ob man eine feministische Borderlinerin (»Jessica Jones«), einen steinreichen Sonnyboy (»The Arrow«) oder einen schwarzen Gerechtigkeitskämpfer (»Black Lightning«) bevorzugt – für jede Vorliebe gibt es eigens zugeschnittene Superheld*innen.
Schneeflocken
Es ist, als wären gerade Angehörige jüngerer Generationen richtiggehend versessen darauf, sich in Lebensgeschichten von Menschen hineinzudenken, die mit außergewöhnlichen, übermenschlichen Gaben gesegnet sind.
Man kann dieses Bedürfnis, auf das die Serien- und Filmindustrie äußerst produktiv reagiert, wohl verschieden deuten. Unübersehbar ist darin jedenfalls die Suche nach Individualität, nach Einzigartigkeit. Das passt zu den Prozessen der Identitätssuche und Selbstfindung, welche Jugendliche und Twentiesomethings als die Hauptzielgruppe solcher Formate gewöhnlich durchlaufen.
Die Idee liegt auch nahe, diese Faszination für Superheld*innen zu den Nebenwirkungen einer Generation zu zählen, welche von klein auf in ihrer Einzigartigkeit bestätigt wurde. Populärsoziologisch hat man von der »Generation Snowflake« gesprochen – von jungen Menschen also, denen ihre Eltern vor jedem Tag im Kindergarten schon ins Ohr geflüstert haben, dass sie ganz unverwechselbare, einzigartige Schneeflocken seien. Und dass nichts und niemand sie davon abbringen dürfe, sich als ein solches Unikat zu begreifen.
Wassertropfen
In den Umtriebigkeiten des Lebens und besonders im gruppendynamischen Sog der sozialen Medien, sicher auch in den Anforderungen des Arbeits- und Familienalltags, wird dieser Glaube an die eigene Einzigartigkeit allerdings stark herausgefordert. In Fortsetzung der Snowflake-Metaphorik könnte man auch sagen:
Die Hitze der spätmodernen Lebensrealität lässt so manche »unverwechselbare Schneeflocke« zu einem ausgesprochen eigenschaftsneutralen, austauschbaren Wassertropfen zusammenschmelzen.
Das ist übrigens auch der Zusammenhang, in welchem der Ausdruck wohl zum ersten Mal in diesem Sinne begegnet: Der namenlose (!) Protagonist des gefeierten David-Fincher-Streifens »Fight Club« teilt mit diesen Worten seine Gedanken zum Alltag einer oberflächlichen Konsumgesellschaft:
»Ihr seid nichts Besonderes. Ihr seid keine wunderschönen, einzigartigen Schneeflocken. Ihr seid genauso verweste Biomasse wie alles andere. Wir sind der singende, tanzende Abschaum der Welt. Wir sind allesamt Teil desselben Komposthaufens.«
Einzigartigkeit
Die Spannung zwischen elterlichen Einzigartigkeitsbekundungen und gesellschaftlichen Gleichschaltungsprozessen schlägt uns hier mit vollen Wucht entgegen. In »Fight Club« erwächst daraus eine kämpferische Protestbewegung von Männern, die aus dem »System« aussteigen und sich gewaltsam Gehör verschaffen – Ähnlichkeiten mit den Trump-begeisterten »Proud Boys« sind augenfällig.
Die mediale Superhelden-Industrie unserer Tage scheint indes auf eine andere Logik zu setzen. Sie ermutigt meist nicht den Ausstieg aus den Systemen, sondern hält den Anspruch der Einzigartigkeit innerhalb der Systeme hoch:
Zahllose Geschichten »normaler« Menschen, welche ihre Superkräfte entdecken und sich über die graue Normalität hinwegsetzen, bieten Haftflächen gerade für junge Menschen, die auf der Suche sind nach dem, was sie in dieser Welt unverwechselbar macht.
Letztlich scheint es darum zu gehen, in einer Gesellschaft, welche Mädchen zu Duck-Face-Instagram-Bitches erzieht oder sie auf TikTok alle zum selben Song tanzen lässt, einfach noch öfter und noch lauter an die schneeflockenähnliche Einzigartigkeit jedes Menschen zu erinnern.
Besonderheiten
Das ist sicher gut gemeint. Das Problem dabei ist aber doch, dass das Angebot, sich in den Narrativen popkultureller Superheld*innen wiederzufinden, auf eine falsche Fährte zu führen droht. Denn was diese Protagonist*innen einzigartig macht, sind ja außergewöhnliche Begabungen, übermenschliche Fähigkeiten, die niemand sonst besitzt. Sie heben sich durch objektiv feststellbare Besonderheiten aus der Masse heraus.
Wer als Seelsorger schon mit Menschen zu tun hatte, die an ihrer Mittelmäßigkeit verzweifelten und vergeblich an sich selbst nach Eigenheiten suchten, die sie zu etwas Besonderem machten, wer schon mit Teenagern gesprochen hat, die ihre Durchschnittlichkeit in Sport, Gesang, Intelligenz, »Schönheit« usw. als Verurteilung zur Bedeutungslosigkeit verstanden – der weiß, dass es gerade andersrum laufen muss:
Wir haben nicht Bedeutung und Wert, weil wir einzigartig und außergewöhnlich sind – wir sind einzigartig und außergewöhnlich, weil wir Bedeutung und Wert haben.
Zuwendung
Und ich bin immer noch überzeugt, dass sich diese Wahrheit nur theologisch wirklich einholen lässt. Reformatorisch würde man sagen: Unsere Bedeutung und unser Wert entscheidet sich letztlich »Coram Deo«, im Angesicht Gottes.
Wir sind wertvoll und bedeutsam in den Augen Gottes – nicht als ein austauschbares Exemplar der Spezies Mensch, sondern als Person, der sich Gott liebevoll zugewandt hat. Das macht uns »einzigartig und außergewöhnlich« – auch ohne Superkräfte und übernatürliche Begabungen.
Diese Zuwendung Gottes können und sollen Menschen natürlich auch durch andere Menschen erfahren. Das ist es ja, was vielen Menschen in aller Durchschnittlichkeit dann doch die Gewissheit gibt, nicht in der Masse untergehen zu müssen: Weil sie für nahestehende Menschen auch ohne Superkräfte nicht austauschbar sind. Weil sich ihnen jemand zuwendet und ihnen Wert, Bedeutung zuspricht. Gehört nicht gerade das zur Berufung jener Gemeinschaft, die sich traditionell »Kirche« nennt?
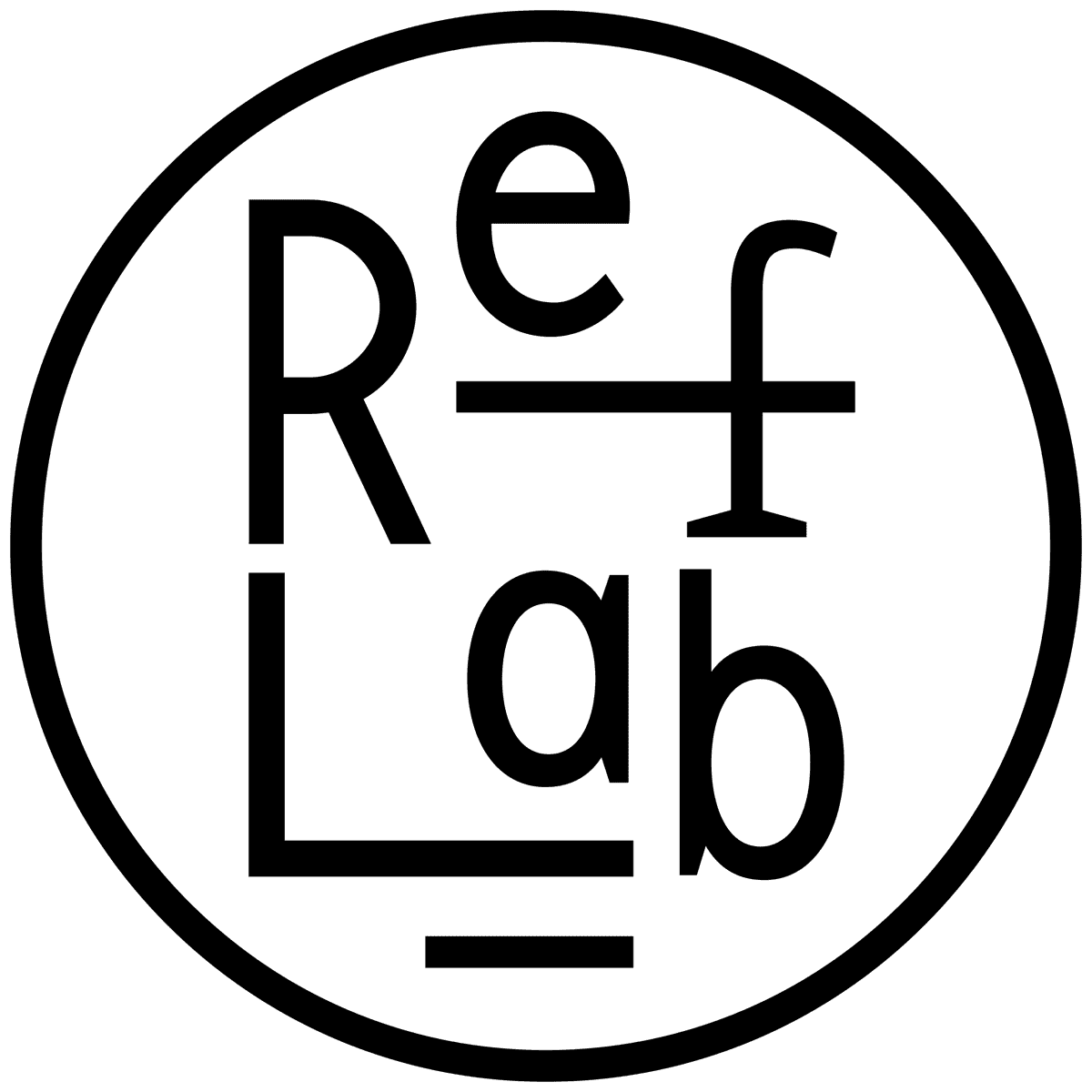







1 Gedanke zu „Wir sind alle Superhelden. Nicht.“
Ja genau. Danke für diesen tiefgründigen, wunderbaren Text.
Das eine ist geliehene Identität, das andere wahre.
Das eine setzt unter Dauerstress genügen zu müssen, das andere macht dankbar, entspannt und setzt Energie frei für das Eigene.
Mein Ja zu meiner Durchschnittlichkeit ist auch ein Ja zu Gottes Schöpferkraft in und durch mich. Leben und feiern wir das gemeinsam beim Kirchenkaffe oder mit einem Glas Wein, Bier oder Wasser anschliessend!