Verstörende Religion
Nirgendwo im Westen ist Politik so religiös geprägt wie in den USA. Diese spirituelle Dimension ist schon im Normalfall aus europäischer Sicht kaum verständlich. Manche Erscheinungen im Umfeld der aktuellen Wahl 2020 haben ein neues Niveau verstörender Religionskultur erreicht. Etwa die Art und Weise, wie die offizielle spirituelle Beraterin des US-Präsidenten Paula White sich in Trance betet, um dämonische Mächte an einem Wahlbetrug zu hindern. Oder der Auftritt von Kenneth Copeland, einem der weltweit einflussreichsten evangelikal-pentekostalen Prediger der letzten Jahrzehnte, der die einhellige Einschätzung der Medien, dass Biden die Wahl gewonnen habe, mit einem Lachen quittiert, das viele als gruselig empfinden.
Die vielfach im Netz geteilten Filme sind so verstörend, weil sie das Gefühl untergraben, in derselben Welt zu leben.
Kann man so etwas noch irgendwie nachvollziehen? Ein wenig schon.
Kognitive Dissonanz und ihre Folgen
»Wenn Prophetie scheitert« – so lautet der Titel eines der bedeutendsten Klassiker der Sozialpsychologie von Leon Festinger u.a. von 1957. Eine Gruppe junger Psychologen entdeckte Anfang der fünfziger Jahre eine Ufo-Sekte, die sich auf den baldigen Weltuntergang vorbereitete. Die Forscher erkannten darin eine einmalige Chance auf teilnehmende Beobachtung der besonderen Art: Sie schlossen sich der Gemeinschaft an, um aus nächster Nähe studieren zu können, wie die Gruppe mit dem Scheitern ihrer Weissagung umgehen würde. Dabei gingen Festinger und Co. von folgender Fragestellung aus: Was passiert mit einem Glauben,
- dem ein Mensch mit ganzem Herzen anhängt und nach dem er sein Leben ausrichtet,
- wenn dieser so offensichtlich wie möglich widerlegt wird und
- die Gläubigen dies gemeinsam in einem dichten sozialen Zusammenhalt erleben?
Festinger hat vor Beginn der Untersuchung eine Hypothese aufgestellt, die auf dem ersten Blick erstaunen mag: Die meisten Mitglieder einer solchen religiöse Gruppe werden ihren Glauben nicht aufgeben, sondern im Gegenteil sich noch intensiver seiner missionarischen Verbreitung widmen. Tatsächlich erwies sich diese Hypothese als richtig.
Der ausgebliebene Weltuntergang führte bei den meisten nicht zu einem Abfall vom Glauben, eher sogar zu einer Steigerung ihrer Missionsbemühungen.
Warum in aller Welt sind starke Überzeugungen so faktenresistent? Festinger und andere entwickelten aus dieser Beobachtung heraus die Theorie der kognitiven Dissonanz. Menschen lieben das Gefühl der Konsonanz von Denken und Wirklichkeit, Überzeugung und Praxis. Sie brauchen Stimmigkeit. Darum ertragen sie Dissonanzen so schlecht. Menschen streben nach Dissonanzabbau.
Das kann in unterschiedliche Richtung geschehen. Das Einfachste wäre natürlich, bei einer Diskrepanz von Überzeugung und erfahrbarer Wirklichkeit seine Überzeugungen an die Wirklichkeit anzupassen. Aber bei starken ideologischen Überzeugungen geschieht das nicht. Solche Überzeugungen sind Teil der eigenen Identität geworden. An ihnen festzuhalten, ist nun keine Wahrheitsfrage mehr, sondern eine Charakterfrage. Für die Betroffenen geht es um Treue und Mut. Vor allem gilt: Je mehr man für die eigene Überzeugung geopfert oder gelitten hat, desto stärker hält man sie fest.
Schon Nietzsche sagte: »Die Menschen schätzen ein Ding nach dem Aufwand, den sie um seinetwillen gemacht haben.«
Sehr wesentlich ist aber auch die Gemeinschaft, in die man eingebunden ist. Beim ausgebliebenen Weltuntergang der Ufo-Sekte wandten sich nur diejenigen vom Glauben ab, die den ausgebliebenen Weltuntergang nicht mit den anderen gemeinsam erlebt hatten oder insgesamt nicht so stark in die Gruppe eingebunden waren. (Das sollte man beim Widerstand radikaler religiöser Gruppen gegen die Corona-Regeln mitbedenken, dass die Aufforderung zu physischer Distanzierung etwas für diese Gruppen schlechthin Notwendiges unmöglich macht.)
Man könnte versucht sein, diesen Mechanismus zu verstehen als Bauplan für fundamentalistische Gemeinschaften: verlange möglichst große Opfer von deinen Gläubigen und achte darauf, dass sie stets in dichte Gemeinschaft eingebettet sind (Kleingruppen). Religiöse Gruppen, die sich an diese beiden Faktoren halten, werden mindestens kurz- und mittelfristig deutlich erfolgreicher sein als Gemeinschaften, die eigenständiges Denken fördern.
Aber vielleicht sollte man auch nicht übersehen, dass es in diesem leidenschaftlichen Kampf, am Glauben festzuhalten, auch um etwas geht, was zutiefst menschlich ist. Mehr noch: das wesentlich zum Glauben gehört.
Manchmal braucht es Glaube gegen allen Augenschein. Manchmal gibt einem das, was man sieht, keinen Grund zur Hoffnung (Röm 8,24). Manchmal muss man festhalten an dem, »was man nicht sieht« (Hebr 11,1) und »auf Hoffnung hin glauben, wo keine Hoffnung ist« (Röm 4,18), im vollen Bewusstsein, dass solche Hoffnung nicht im Schauen gründet, sondern im Glauben (2Kor 5,7). Das Ringen um einen solchen Glauben ist alles andere als lächerlich.
Geht es nicht für viele Gläubige heute letztlich auch darum, nur ganz anders:
Um das Festhalten an einem prophetischen Glauben, der nicht die Nähe der Mächtigen, sondern der Ohnmächtigen sucht. Der seine Feinde segnet, statt ihren Untergang sehen zu wollen.
Der überhaupt nur da von Feinden redet, wo es um die Liebe zu ihnen geht. Um eine Hoffnung gegen den Augenschein, dass es noch nicht zu spät ist, sich gemeinsam Menschheitsherausforderungen wie der Weltklimakrise zu stellen.
Mögliche Auswege
Man sollte nicht erwarten, dass die Enttäuschung einer tiefen Glaubenshoffnung zu einer grundlegenden Revision dieses Glaubens führen wird. Für Menschen, die ihren religiösen Glauben und die Zustimmung zu Trump eng verzahnt haben, ist das eine Ausnahmezustand. Sie wollen an ihrem Glauben unbedingt festhalten. Dies kann ihnen aber nur gelingen, wenn sie ihren Glauben wenigstens teilweise weiterentwickeln. Sie müssen es schaffen, eine neue Gestalt ihres Glaubens zu finden, ohne das Gefühl zu haben, ihrem Glauben untreu geworden zu sein.
- Natürlich kann es passieren, dass Einzelne das nicht schaffen und ganz aussteigen. In den letzten Jahren sind nicht wenige Menschen, die mit einer solchen Frömmigkeit groß wurden, ausgestiegen; und zwar sehr häufig dann, wenn sie aus Gründen des Studiums bzw. der Arbeit umziehen mussten und Abstand gewannen gegenüber der bisherigen sozialen Einbindung in solche Überzeugungsgemeinschaften. Nicht selten verlassen sie dann nicht nur eine solche Prägung, sondern jede Form organisierter Religion. Aber höchst wahrscheinlich wird das die Ausnahme bleiben.
- Man sollte nicht unterschätzen, wie flexibel sich Glaubenshaltungen auch in streng religiösen Bewegungen entwickeln können. Eines der berühmtesten Beispiele sind die Zeugen Jehovas, die in ihrer Geschichte immer wieder die Wiederkunft Jesu für ganz bestimmte Jahre vorhersagten (1878, 1881, 1914, 1918, 1925 und 1975); und es jedes Mal schafften, am Scheitern dieser Weissagung nicht zu zerbrechen. Es gelang ihnen, ihre Geschichte weiterzuerzählen, z.B. mit der Deutung, dass Jesus tatsächlich seine Herrschaft angetreten habe, aber unsichtbar im Himmel.
- Jetzt schon kann man beobachten, dass bei weniger extremen religiösen Trump-Anhängern eine Veränderung einsetzt: sie setzen sich dafür ein, künftig den Stellenwert des Politischen weniger stark zu betonen. In gemäßigt evangelikalen Kreisen, wie sie von der Zeitschrift Christianity Today repräsentiert wird, kann man beobachten, dass man zwar nicht mit den bisherigen Überzeugungen brechen möchte, aber künftig mehr missionarisch als politisch in die Öffentlichkeit wirken will.
Natürlich wäre es wünschenswert, dass solcher Kreise nicht nur den Stellenwert des Politischen, sondern das eigene Verständnis von Politik in Frage stellen würden. Dass sie Politik nicht als Ort des Machtkampfes verstehen, sondern als Raum, in dem um das Gute mit anderen und für andere gestritten wird. Aber angesichts der apokalyptischen Weltsicht und dem tiefsitzenden Ressentiment gegen alles Progressive, ist im Moment keine Massenbewegung in diese Richtung zu erwarten.
Und da sind wir wieder beim Thema:
Am Glauben festhalten. Alle, die sich so etwas wünschen, brauchen gerade jetzt einen Glauben gegen den Augenschein und die Hoffnung auf das, was man nicht sieht. Ohne Trance und Gelächter. Mit Liebe und Geduld.
Photo by chester wade on Unsplash
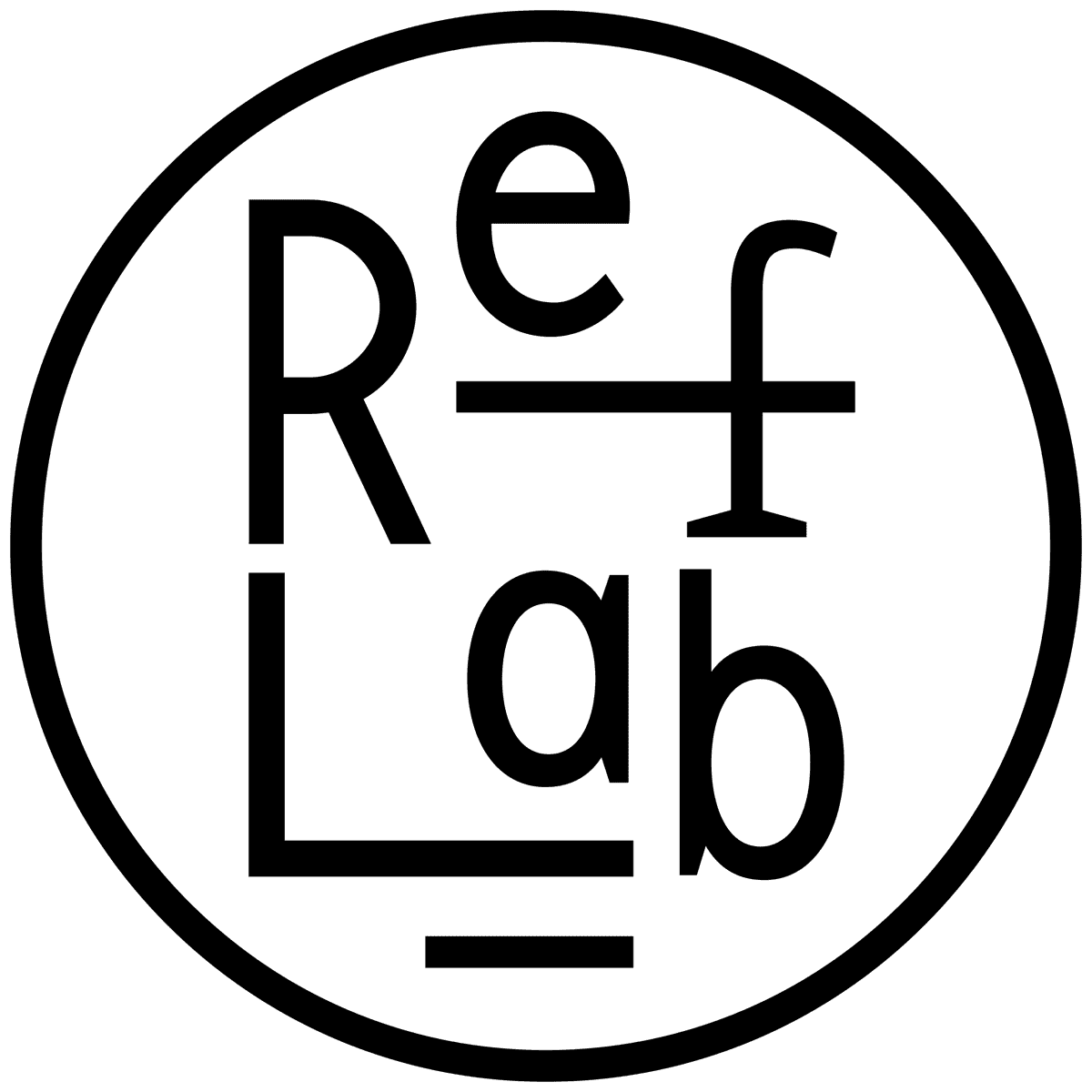









4 Gedanken zu „Wenn Prophetie scheitert“
Am Glauben festhalten … das Problem ist wohl dies, dass das objektivierende “glauben an” -was immer wir auch als unverzichtbaren Gegenstand dieses Glaubens postulieren – zu unserer Sache machen. Es scheint mir im Himmel und auf Erden doch vielmehr um “vertrauen” in actu und nicht ums Credo zu gehen. Vielmehr ergibt sich dem und der Vertrauenden etwas, das wir weder festhalten können noch müssen – schon gar nicht krampfhaft – sondern von dem wir belebt werden und weiter leben können.
Von Aristoteles stammt der Satz: “Wer lernen will, muss glauben.”
Andererseits will jede Prophezeiung geglaubt sein, egal, ob sie scheitert oder nicht.
Die Prophezeiung vom ‘Ewigen Leben’ gemäß Joh. 17 lautet: “Das ewige Leben besteht darin, den einzigen Gott zu erkennen und den, den er gesandt hat, Jesus Christus.”
Das kann man glauben, wenn man den Satz gelernt hat.
Ziemlich Off-topic, aber ich schreib es jetzt trotzdem: “Nirgendwo im Westen ist Politik so religiös geprägt wie in den USA.” Das stimmt m.E. so nicht. In Brasilien, das kulturell und geographisch eindeutig zum Westen gehört, ist die Politik in noch sehr viel stärkerem Mass religiös geprägt. Übrigens nicht nur, wie oft kolportiert, auf der Rechten Seite. Auch Linke wie z.B. Ex-Präsident Lula hatten ein enges Verhältnis zu kirchlichen Kreisen. Es gibt zahlreiche Pfarrer, die Abgeordnete sind (etwas, was mir aus den USA nicht bekannt ist) und Kirchen, die eigene Parteien haben (ebenfalls etwas, das es in den USA nicht gibt). Vielleicht ist unser Blick auf den Westen manchmal etwas verengt auf Europa plus die angelsächsische Welt. Weite Teile des hispanischen und lusitanischen Sprachraums gehören aber genauso zum Westen.
Danke für den Hinweis, das ist ganz sicher richtig, wenn man den Begriff Westen nicht zu eng fast. Der Begriff wird ja zunehmend anachronistisch, aber einstweilen haben wir für unsere heutige Weltlage noch keine neue, allgemeinverständlich Sprache.