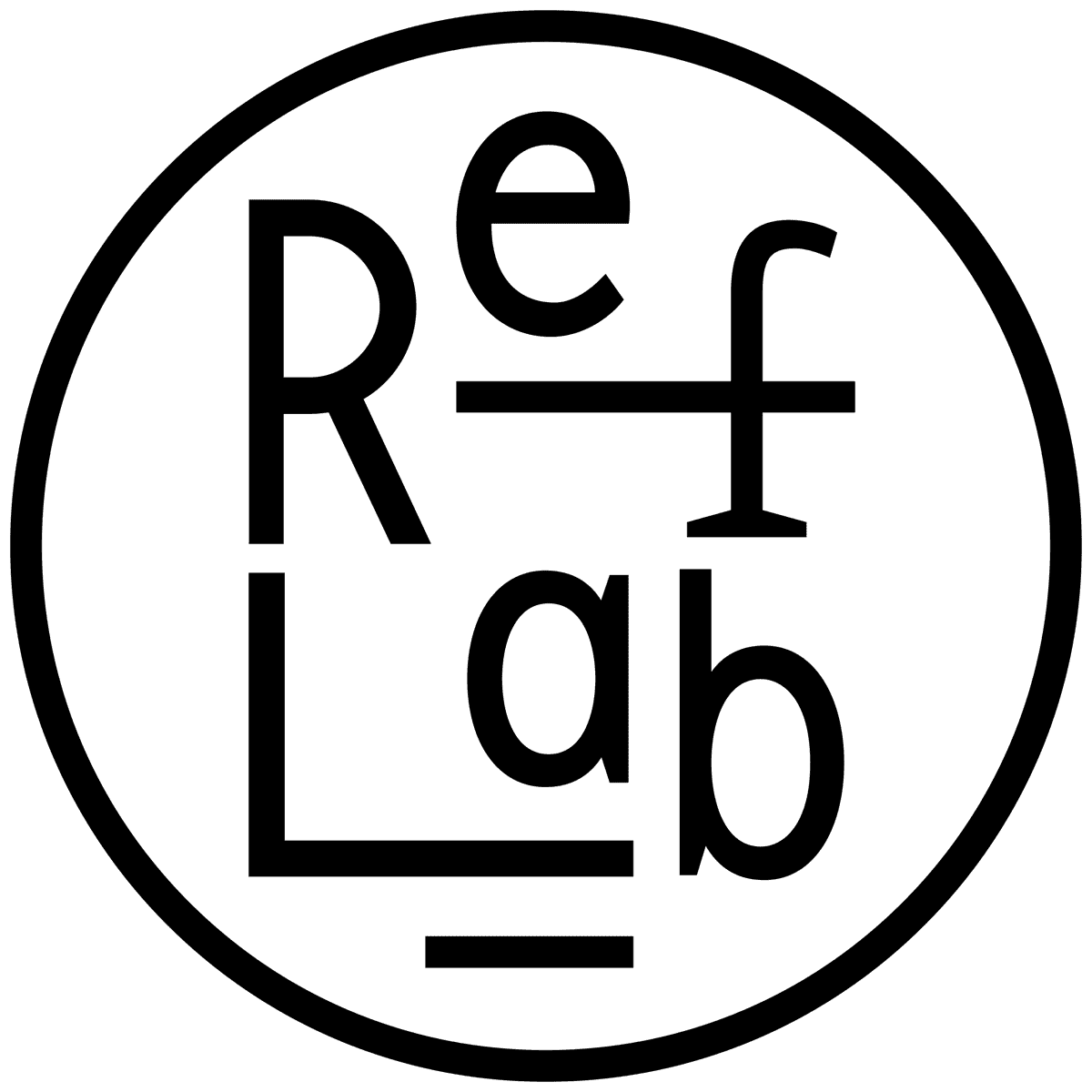Ich wünschte, ich könnte nach den Ferien allein und der Erkenntnis, dass ich mich selbst am meisten verurteile, davon berichten, dass alles gut war. Dass ich nach dem Erlebnis mit meinen Freund:innen, die cool auf mein Alleinsein und mein Alleinleben mit Katzen reagierten, ebenso fein war damit. Dass ich meine innere Checkliste zerriss und glücklich und frei ohne sie lebte.
Checkliste zerreissen, Checkliste befolgen
Doch nach einer wichtigen Erkenntnis folgen oft nagende Zweifel: War das alles wirklich eine gute Idee? Ist es sicher, diese Checkliste zusammenzuknüllen und sich neu zu orientieren?
Hält das Ungewisse Gutes bereit? Oder sollte ich nicht auf Altbewährtes setzen, das mich so lange trug?
Schneller als schnell packt einen die Panik, dass man womöglich eine richtig dumme Entscheidung getroffen hat. Daher ist der nachfolgende Abstecher nicht besonders glorios. Sauna, gute Erkenntnisse, liebevolle Menschen? Innert Sekunden weg, als ich im späten Herbst meine Masterarbeit schrieb, allein im Dunkeln aufstand, allein in der Bibliothek sass und wieder allein einschlief.
Es brauchte wenig, dass mich die Angst beschlich, dass ich nie wieder jemanden finden würde. Und es brauchte noch weniger, dass diese Angst durch den nasskalten Herbst, in dem man nicht mehr gleich häufig ausgeht wie im Sommer, so überdimensional aufgeblasen war, dass ich mich bei einer Onlinedating-Plattform anmeldete.
Heilige oder Hure
«Zusammen ist man weniger allein» oder die religiöse Variante «Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei», hört man von verschiedenen Seiten der Gesellschaft.
In derjenigen Welt, in der ich aufwuchs, standen einer Frau zwei Wege offen: Heilige oder Hure.
In meinen nichtkirchlichen Kreisen galt es als besser, sich in möglichst viele Begegnungen zu stürzen und so zu tun, als könnte man einfach weitermachen. Egal ob man sich bereit dazu fühlte oder nicht: Hauptsache, man blieb keine fragwürdig lange Zeit allein.
Aus konservativ-religiöser Sicht galt das allerdings als moralisch äusserst verwerflich. In diesen Kreisen sieht man es als Tugend, ätherisch zölibatär zu leben und sich irgendeinem Dienst, bestenfalls dem Kindergottesdienst zu verschreiben, bis man die eine Person fürs Leben gefunden hat. Besser die Fassade «unbefleckter Single» wahren als zugeben, wie sehnlichst-verzweifelt man sich menschliche Nähe wünscht. Aus nichtreligiöser Sicht war man dann allerdings ein «Backfisch».
Mittelweg: Fehlanzeige. Den würde ich mir selbst suchen müssen. Da von meiner persönlichen Religiosität nicht allzu viel übrig war und ich keine Lust mehr hatte, mich heiliger darzustellen als ich war, ging ich in die Richtung, in die ich mich bis dahin noch nie gewagt hatte.
Langweiliges Schlaraffenland
Vom einen auf den nächsten Moment boten sich plötzlich tausend Möglichkeiten. Es war euphorisierend. Der Algorithmus spülte Menschen auf den Bildschirm, die mit meinen Interessen, Werten und politischen Ansichten übereinstimmten. Alle waren sympathisch. Doch relativ schnell setzte Ernüchterung ein.
So aufregend leicht es war, Menschen kennenzulernen, so schwierig war es, jemanden zu finden, bei dem man dachte: «Wow!» Keiner war so richtig blöd, aber keiner richtig toll. Logisch waren Werte und Interessen wichtige Grundpfeiler.
Ich hatte nicht vor, die Jungversion von Roger Köppel zu daten. Aber von Wokeness erschlagen zu werden, war irgendwie auch nicht sexy. Vor allem, weil es überhaupt nichts darüber aussagte, ob und wie eine Person im Alltag Gleichberechtigung lebte.
Ich fand es enorm komisch, Menschen in einem reinen Dating-Kontext kennenzulernen.
Wenn ich ehrlich war, hatte ich die spannendsten Menschen losgelöst davon kennengelernt und man hatte sich an- und miteinander entwickelt.
Trügerisches Schlaraffenland
Ausserdem war es ernüchternd, wie flüchtig und beliebig die Welt des Online-Datings sein konnte. Versprochene Kontaktaufnahmen, ausgemachte Dates, alles konnte sich in letzter Minute in Luft auflösen.
Ich lernte erstaunlich viele Menschen kennen, die überhaupt nicht bereit waren für eine Beziehung und merkte, dass ich eine von ihnen war.
Obwohl ich es hasste, allein zu sein, hatte ich überhaupt kein emotionales Polster, die Menschlichkeit anderer auszuhalten. Nicht jetzt. Und ganz offensichtlich hatten sie keins, meinen Unsicherheiten liebevoll zu begegnen.
Also sagte ich allen, dass ich zu optimistisch unterwegs gewesen war und meine Masterarbeit zuerst unter Dach und Fach bringen musste. Alle verstanden und waren supernett. Es war die positivste Erfahrung im gesamten Onlinedating.
Ich setzte mich wieder allein in die Bibliothek, fuhr mit Freundinnen zu Ikea, kugelte auf Sofas herum und erarbeitete mit ihnen Farbkonzepte, um ihre Weihnachtsbäume zu dekorieren. Und obwohl es mich innerlich fast zerriss, wusste ich, dass es besser war, wenn ich zuerst mein eigenes Chaos sortierte, bevor ich mich auf die chaotische Welt des Datings einliess.
Tschüss Schlaraffenland
Es war hart einzusehen, dass es manchmal andere Prioritäten gibt, als jemanden kennenzulernen.
Singlesein heisst auch, Phasen auszuhalten, in denen man unfreiwillig allein ist.
An kaum einem Tag der folgenden Monate sass ich glücklich in der Bibliothek. Ich schleppte mich morgens an den Tisch, boostete mich mit veganen Schoggigpifeli, Espresso und Spaziergängen an der frischen Luft. Abends traf ich Lieblingsmenschen, machte Sport und heulte regelmässig, sobald ich nach Hause kam. Ich fühlte mich fürchterlich und der Situation überhaupt nicht gewachsen.
Natürlich, heute stehe ich da und weiss, ich war der Sache gewachsen. Sonst hätte ich es nicht hinbekommen. Es war nicht glamourös. Nicht tiefenentspannt.
Ganz sicher war ich kein glücklicher Single.
Stark fühlte ich mich sowieso nicht. Aber Ende Dezember, nach einer Nachtschicht morgens um halb Sieben, sauste die Masterarbeit durch den Äther des Internets. Wenige Monate später flatterte ein Papier in den Briefkasten. Tinte und Stempel, die bescheinigten: Es ist vorbei. Das wird nicht wieder passieren.
Kein Zuckerschlecken
Doch es ist eine der Lebensphasen, in die ich keinen Sinn hineininterpretieren will. Bis heute hallt der Schmerz nach und ich weigere mich, eine Predigt daraus zu machen. Man muss solche Phasen nicht perfekt überstehen. Man muss keinen Nutzen daraus ziehen.
Es gibt am Ende keine Note, ob man es gut macht und die Reise hört auch nicht auf, selbst wenn man datet.
Nähe und Distanz sind immer wieder Thema in zwischenmenschlichen Beziehungen, selbst in Freund:innenschaften. Viel wichtiger ist, dass man weiss: Ich überlebe dieses schwarze Loch.
Illustration: Rodja Galli