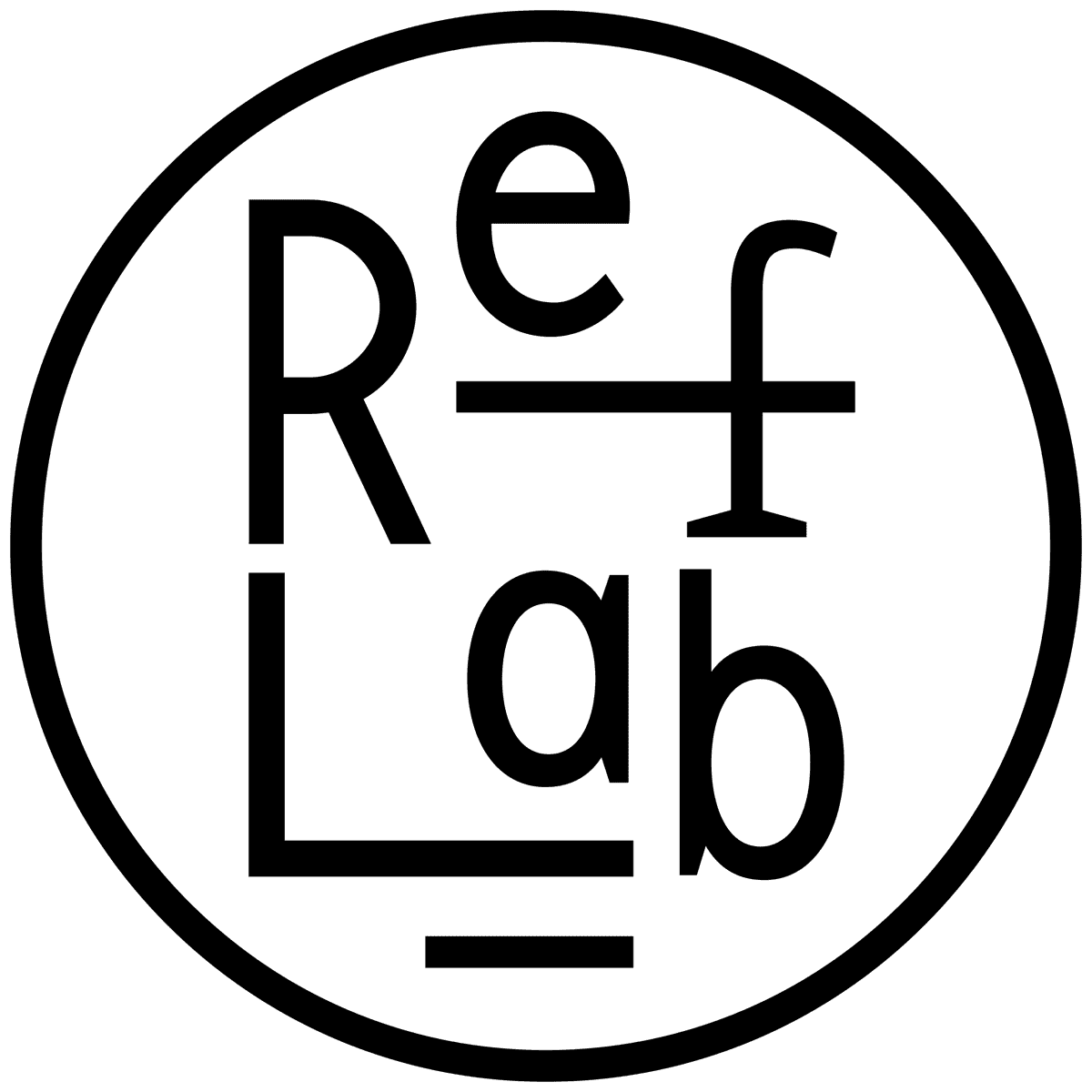Im 2020 erschienenen «Feminismus-Buch: Große Ideen einfach erklärt» wird es auf den Punkt gebracht: Das Patriarchat ist ein «Sozialsystem, in dem Männer die Macht haben und Frauen grösstenteils oder vollständig von der Machtausübung ausgeschlossen sind; ein System, in dem der Vater oder der älteste Mann der Haushaltsvorstand ist, mit einer Erbfolge über die männliche Linie.»
Die Schweiz war lange ein Patriarchat: Frauen durften auf nationaler Ebene bis 1971 weder stimmen noch gewählt werden (in den Kantonen Appenzell blieb es ihnen bis 1991 verwehrt), bis zur Revision des Ehegesetzes 1988 konnte Frauen ohne die Unterschrift ihres Ehemannes kein eigenes Bankkonto eröffnen und Vergewaltigung in der Ehe war juristisch nicht strafbar. Gleichgestellt in der Verfassung sind Frauen seit 1981, in Kraft getreten ist das Gesetz 1996. Menschen mit Behinderung können sich seit 2004 gerichtlich gegen Diskriminierung wehren.
Gleichgeschlechtlich liebende Menschen mussten bis 1992 auf die Gleichstellung warten. Das Antidiskriminierungsgesetz wurde im Februar 2020 angenommen. Zivilrechtlich können gleichgeschlechtliche Paare nach wie vor nicht heiraten. Unter dem Strich klingt das trotzdem positiv, mal abgesehen von der Ehe für alle, oder? Auf einer begrifflichen Ebene und im öffentlichen Raum leben wir nicht mehr im Patriarchat. Wer heute patriarchale Strukturen erfährt, tut dies nur noch in familiären Verhältnissen oder in gemeinschaftlichen Strukturen wie Brüdergemeinden, in denen sie aktiv weitergelebt werden.
Wir sind erst am Anfang
Doch die Geschichte der Freiheit und der Gleichberechtigung ist noch zu jung, als dass wir uns von allen Strukturen des Patriarchats gelöst hätten.
Vor dem Gesetz mögen Menschen inzwischen gleichgestellter sein. Das Erbe misogyner, queerfeindlicher, antisemitischer und rassistischer Strukturen, welche die Gesellschaftsvorstellungen und Rollenerwartungen prägen, ist nicht einfach verpufft. Im Alltag leben viele dieser Strukturen weiter.
Hier meine These: Ein Durchschnittsmensch in der Schweiz wird bis heute männlich, weiss, heterosexuell, nicht behindert und christlich gedacht. Das ist für mich ein klares Erbe männergeformter und männerdominierter Strukturen. Oder wie man eben auch sagen könnte: ein Erbe eines «Patriarchats», da viele theologische und philosophische Texte, welche unsere Gesellschaft geprägt haben, historisch weiter zurückreichen als vorgestern und nun mal aus der Feder von Männern stammen.
Einige Beispiele gefällig? Wer sich in einer evangelischen Blase bewegt, kommt um antisemitische oder auch misogyne Äusserungen Luthers nicht herum.
Zum Tod der Frau im Kindbett schrieb der Reformator: «Ob sie sich aber auch müde und zuletzt tot tragen, das schadet nicht. Lass (sie sich) nur tot tragen, sie sind darum da. Es ist besser kurz gesund denn lange ungesund leben».
Der Philosoph Kant schrieb: «Die Menschheit ist in ihrer grössten Vollkommenheit in der Rasse der Weissen. Die gelben Indianer haben schon ein geringeres Talent. Die [N-Wort] sind weit tiefer, und am tiefsten steht ein Teil der amerikanischen Völkerschaften.» Und der Philosoph Georg Wilhelm Friedrich Hegel sagte in seinen «Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte»: «Der [N-Wort] stellt den natürlichen Menschen in seiner ganzen Wildheit und Unbändigkeit dar … Es ist nichts an das Menschliche Anklingende in diesem Charakter zu finden.»
Ist es verkürzend gegenüber den Geistesgrössen, einfach ein paar der schlimmsten Zitate herauszupicken? Wahrscheinlich. Doch solche Wertungen und Abwertungen laufen auch heute noch einfach mit. Wir merken es oft nicht einmal. Zu viele Menschen kommen in der Schweiz zu gut durchs Leben, als dass sie das historische Erbe struktureller Ungleichbehandlungen wahrnehmen und kritisieren könnten.
Kämpfe im Abseits
Wer nicht zu diesem konstruierten gesellschaftlichen Ideal gehören kann oder will, muss ständig zwischen Nichtauffallen und Auffallen im richtigen Moment balancieren. Das kostet unfassbar viel Energie.
Eines der jüngeren Beispiele ist das Verschwinden und der Mord der 33-jährigen Sarah Everard in London. Unter vulnerablen Menschen gibt es einen ungeschriebenen Kodex: Den einen Kopfhörer im Ohr, um sich mit Musik abzulenken, den anderen Kopfhörer draussen, damit wir alles hören können, wenn wir nachts nach Hause laufen.
Wir Mädchen und Frauen vermeiden dunkle Strassen und/oder telefonieren mit Mitbewohner*in oder der Freund*in, wenn wir abgeschiedene Wegstücke nicht vermeiden können. Taxis können wir uns nicht immer leisten. Wir erschrecken, wenn jemand im gleichen Tempo hinter uns geht.
Wir tragen Turnschuhe, um im Notfall rennen zu können und halten den Schlüsselbund in der Hand, falls wir uns wehren müssen. Wir schreiben uns gegenseitig, dass wir gut nach Hause gekommen sind. Auch beim Joggen überlegen sich viele Frauen, was sie anziehen, welchen Weg sie nehmen, ob sie in der Dunkelheit überhaupt noch rausgehen wollen.
Und selbst wenn wir nicht ausgehen, bleiben wir wach. Ich schlafe nicht ein, bis ich den Schlüssel meiner Mitbewohnerin in der Haustüre höre. Sarah Everard hatte alles richtig gemacht: Sie trug Sportkleidung, Turnschuhe und wurde zuletzt telefonierend an einer hell ausgeleuchteten Strasse gesehen. Nach Hause gekommen ist sie trotzdem nicht.
Pro Patriarchatsbegriff
Wenn man alles, so wie Stephan Jütte es in seinem Blogbeitrag («Begriffsmacht und Komplizenschaft») fordert, nach analytischen Kategorien wie misogyne Wortwahl, rassistische Beleidigung etc. sortiert, ist das sicherlich intellektuell korrekt. Gesellschaftlich werden Erfahrungen wie die gerade Geschilderten aber allzu schnell unter «individuelle, subjektiv empfundene Einzelfälle» verbucht, bei denen lediglich ein einzelner Fehler oder eine kurzfristige Entgleisung geschah. Die strukturellen Bedingungen dahinter werden damit nicht in Betracht gezogen.
Wenn man zudem fordert, alles korrekt zu kategorisieren, übersieht man, dass nicht alle Menschen über dieselben intellektuellen Werkzeuge verfügen: Die Welt ist derart komplex geworden, dass mehrere Doktorabschlüsse nicht ausreichen, um komplexe soziale und sprachliche Phänomene zu verstehen, geschweige denn, das Wirtschaftssystem, den globalen Kapitalismus, angemessen dekonstruieren zu können. Menschen, die als Reinigungskräfte arbeiten, an der Kasse sitzen oder unsere Kanäle und Strassen sauber halten, haben nicht immer die nötige Zeit geschweige denn die Ressourcen, sich analytische Trennschärfe anzueignen.
Stephan kritisiert am Patriarchatsbegriff nebst dessen Grobschlächtigkeit und vager Bestimmung («Containerbegriff»), dass er die Gesellschaft polarisiert.
Für mich braucht es den Patriarchatsbegriff. Für mich polarisiert der Begriff zu Recht. Wer nicht bereit ist, das System zu hinterfragen, in dem er aufgewachsen ist, hat für mich den Ernst der Lage nicht begriffen.
Wer verlangt, dass Menschen, die Gewalt und Unterdrückung erleben, ihre Erfahrungen stets respektvoll und analytisch korrekt formulieren, hat vermutlich nicht begriffen, wie schmerzhaft und demütigend solche Erlebnisse sein können. Es braucht die Provokation dieses Begriffs, damit Erfahrungen gehört, ernst genommen und gesamtgesellschaftlich darüber gesprochen wird.
Keine bedrohte Spezies
Dass auch diejenigen, für die die historische Vergangenheit ideal war, nicht ausschliesslich privilegiert sind, dürfte klar sein: Auch weissen, nicht-behinderten, heterosexuellen Cis-Männern wurden Rollen zugewiesen, unter denen sie litten. Dass manche dieser überaus lange privilegierten Exemplare der menschlichen Spezies heute von einer «Hetzjagd» auf weisse Männer sprechen, sich als gesellschaftliche Sündenböcke geschlachtet sehen, oder jammern, dass sie bei Bewerbungen nicht berücksichtigt werden, ist für mich – nach all den Jahrhunderten, in denen Frauen seit der Französischen Revolution und darüber hinaus ihre Rechte einfordern – schwer nachzuvollziehen.
Wenn ein Mann für einen Job nicht infrage kommt, den er gerne haben würde, tut mir das aufrichtig leid. Aber zu viele Frauen wollen bis heute einfach nur sicher nach Hause laufen können, im Minirock und High Heels, oder joggen im Park, ohne ständig Angst vor Übergriffen haben zu müssen.
Um es zusammenzufassen: Unser Gesellschaftssystem ist kein Patriarchat mehr. Das Erbe dieser historisch lang andauernden und tief verankerten Strukturen wirkt aber fort und diskriminiert unterschiedlichste Menschengruppen bis heute. Wir sind auf Begriffe wie «Patriarchat» angewiesen. Auch wenn der Begriff für viele Einzelfälle zu holzschnittartig ist, braucht es die begriffliche Provokation. Ansonsten bleiben Stimmen ungehört, weil sie, als juristisch-sprachlich korrekte Einzelfälle sortiert, an Sichtbarkeit und Wirkkraft verlieren.
«Pussy Hat», March on Washington, Photo by Roya Ann Miller on Unsplash