Als adoleszierendes Mädchen war ich selbst in einem Heim – ich möchte fast sagen: «interniert». Es war ein reines Mädchenheim; kein Wunder, befand sich das Internat doch in einem Nonnenkloster. Dieser lebensgeschichtliche Hintergrund hat meine Aufmerksamkeit für das Sozial- und Coming-of-Age-Drama «La Mif» des Genfer Dokumentar- und Spielfilmregisseurs Frédéric Baillif geschärft.
Der Film wurde am Donnerstagabend beim diesjährigen Züricher Filmfestival (ZFF) mit dem Filmpreis der Kirchen ausgezeichnet. Eine fünfköpfige Jury aus Film- und Kirchenleuten hat das zwischen Dokumentation und Fiktion angesiedelte Werk aus Beiträgen aus der Schweiz, Österreich und Deutschland ausgewählt.
Eine Besonderheit: Die Darsteller sind tatsächliche Heiminsassinnen und Erzieher:innen. Weltpremiere hatte die in französischer Sprache gedrehte Dokufiktion auf der Berlinale.
«La Mif» ist Jugendslang und eine Verniedlichungsform von «Familie». «J’etais avec la mif» schreiben sich Ados über Messengerdienste, wenn sie tatsächlich Zeit mit ihrer Familie verbracht haben oder aber mit engen Freunden, die gefühlt ebenfalls «mif» sind.
In Wirklichkeit sind wir allein
Familie ist der grosse Fetisch in dem preisgekrönten Drama. Alle Mädchen sehnen sich danach. Keiner der Protagonistinnen aber weiss, wie sich Familie anfühlt. Keiner der Teenager kennt die wärmende Geborgenheit und Sicherheit stabiler Familienverhältnisse.
Ein Jugendheim kann die Lücke nur unvollkommen schliessen, selbst mit Erzieherinnen, die wie die Heimleiterin Lora (Claudia Grob als zerbrechlich-starke Althippie mit Indientasche) ihr ganzes Herzblut in ihre Arbeit fliessen lassen.
«Aber in Wirklichkeit sind wir allein», bemerkt eines der Mädchen auf der Schwelle zum Erwachsenenalter – eine fast metaphysische Einsicht.
Das Heim in der Romandie ist kein Kloster mit dicken Mauern, wie ich es als Jugendliche erlebte, aber ebenfalls ein isolierter, entrückter Ort. Die Intension ist es, Heranwachsende fern prekärer Milieus und lauernder Verführungen ein Gefühl von Sicherheit, Stabilität und die Erfahrung von kooperativem Miteinander zu vermitteln.
Für die jungen Menschen, die der Zufall zusammengewürfelt hat, fühlt sich die Isolation als weitere Härteprobe in einem Leben mit schwierigen Vorzeichen an. Das Stigma der problembelasteten Herkunft reist immer mit: «Also Précieuse, dieses Heim beherbergt Jugendliche in schwierigen Situationen», bekommt ein schwarzes Mädchen mit sorgfältig geflochtenen Haaren bei der Ankunft in dem Heim als Erstes zu hören.
Punkkönigin im Land der Arschlöcher
Verzweiflung und angestaute Wut entladen sich bei den Mädchen in Ausbrüchen von Aggression. Dialoge in dem Film gehen so: «Wer bist du?» «Die Punkkönigin im Land der Arschlöcher». Sex zwischen Minderjährigen bringt schliesslich die Institution insgesamt in einer Borderlinesituation.
Ein berührender Moment ist, wenn die Heimleiterin nach der Verabschiedung eines Schützlings eigenhändig die Bettwäsche wechselt. Dieses Abschiedsritual, erklärt sie, stamme aus einer Zeit, als das Heim noch von Nonnen geführt worden sei.
Dass die Mädchen die Figuren und Geschichte, die sie verkörpern, selbst mitentwickeln konnten, macht den Film besonders. So konnten sie Distanz zum Alltag aufbauen und Traumata bearbeiten. Das Spiel entpuppt sich als heilsamer Prozess.
Formal besticht «La Mif» durch die nonlineare Erzählweise. Erzählsplitter sind wie in einem Kaleidoskop angeordnet, Narrative auf raffinierte Weise wie ein Netz versponnen. Der Film mit Laiendarsteller:innen entstand in nur zehn Drehtagen und erhielt bereits auf der Berlinale eine Auszeichnung.
Teilen, ohne zu urteilen
«Es handelt sich um Fiktion», erklärte der Regisseur am Abend der Preisverleihung, «und die Fiktion ist die Realität».
Baillif ist ausgebildeter Sozialarbeiter. Er kennt das Leben in Sozialeinrichtungen aus seinem früheren Beruf. «Ich bin sehr berührt von der Wertschätzung unserer Arbeit durch die Zürcher Kirchen. Als Filmemacher mache ich das gleiche wie die Kirchen: Sozialarbeit. Es geht mir darum zu teilen, ohne zu urteilen.»
«Der Film verleiht den Frauen, die sonst nicht gesehen werden, Sichtbarkeit. Er hebt mit einer dringlichen Stimme die Wichtigkeit solcher Institutionen für unsere Gesellschaft hervor», erklärt die Jurypräsidentin und Filmdozentin Lucie Bader die Juryentscheidung. Neben ihr sassen der Kirchenrat Andrea Marco Bianca (Reformierte Kirche), Synodalrat Tobias Grimbacher (Katholische Kirche), die Medien- und Religionswissenschaftlerin Marie-Therese Mäder (Universität Zürich) und die Preisträgerin aus dem vergangenen Jahr Karin Heberlein (Regie «Sami, Joe und ich») in der Jury des mit 10 000 CHF dotierten Preises.
Der ökumenische Filmpreis hat als Ziel, einen möglichst unverstellten Blick auf Kultur, Religion und Gesellschaft zu werfen. Beim Empfang der Kirchen verlieh der ZFF-Direktor Christian Jungen seiner Affinität zu christlichen Themen Ausdruck. Man brauche nur ein bisschen an der Oberfläche kratzen und schon stosse man auf religiöse Fragestellungen.
Razzien der Mutter Oberin
Der Gewinnerfilm des diesjährigen Kirchenpreises hat bei mir Erinnerungen an meine eigene Internatszeit geweckt. Im Unterschied zu den Figuren in «La Mif» hatten die meisten von uns relativ intakte Zuhause. Viele kamen vom Land und besuchten in der Provinzstadt Schulen. Überforderte Betreuerinnen und panische Angst vor Schwangerschaften der Schutzbefohlenen aber kannten auch wir.
Kleiderschränke von uns Mädchen wurden nach versteckten Kondomen untersucht. Vor dem Abendessen gab es regelmässig Standpauken. Ausgetretene Marmorstufen liessen uns in dem alten Gebäude wie Boote bei Wellengang schwanken. Wir waren zu sechst in einem Zimmer, später zu viert. Gefühle der Einsamkeit konnten einen inmitten der lärmenden Mädchenmenge beschleichen.
Es war aber auch schön: Der Garten war labyrinthisch und voller Verstecke. Unter dem Dach gab es einen grossen Käfig mit Dutzenden heiter zwitschernder Kanarienvögel.
Wir tuschelten oft bis tief in die Nacht hinein und hielten uns an den Händen. Und das beste: die gemeinsame Rebellion gegen die Institution und unsere Umgebung. Ein bisschen wie bei der Mädchen-Gang aus der Romandie.
Im Rückblick haben sich mir sogar die obligatorischen täglichen Gebetszeiten in der Kapelle als positiv eingeprägt, die ich damals nicht mochte. Eine solche Dimension fehlt in dem säkularen Heim. Noch als Erwachsene träume ich immer wieder, das ich mir ein Bett in dem Internat gesichert hätte. Zur Not ins Heim zurückkehren zu können, beruhigt mich merkwürdigerweise in der Tiefe der Seele.
Einen Podcast mit Jurymitglied Marie-Therese-Mäder gibt es hier:
Filmstill aus «La Mif», Copyright: Stephane Gros.
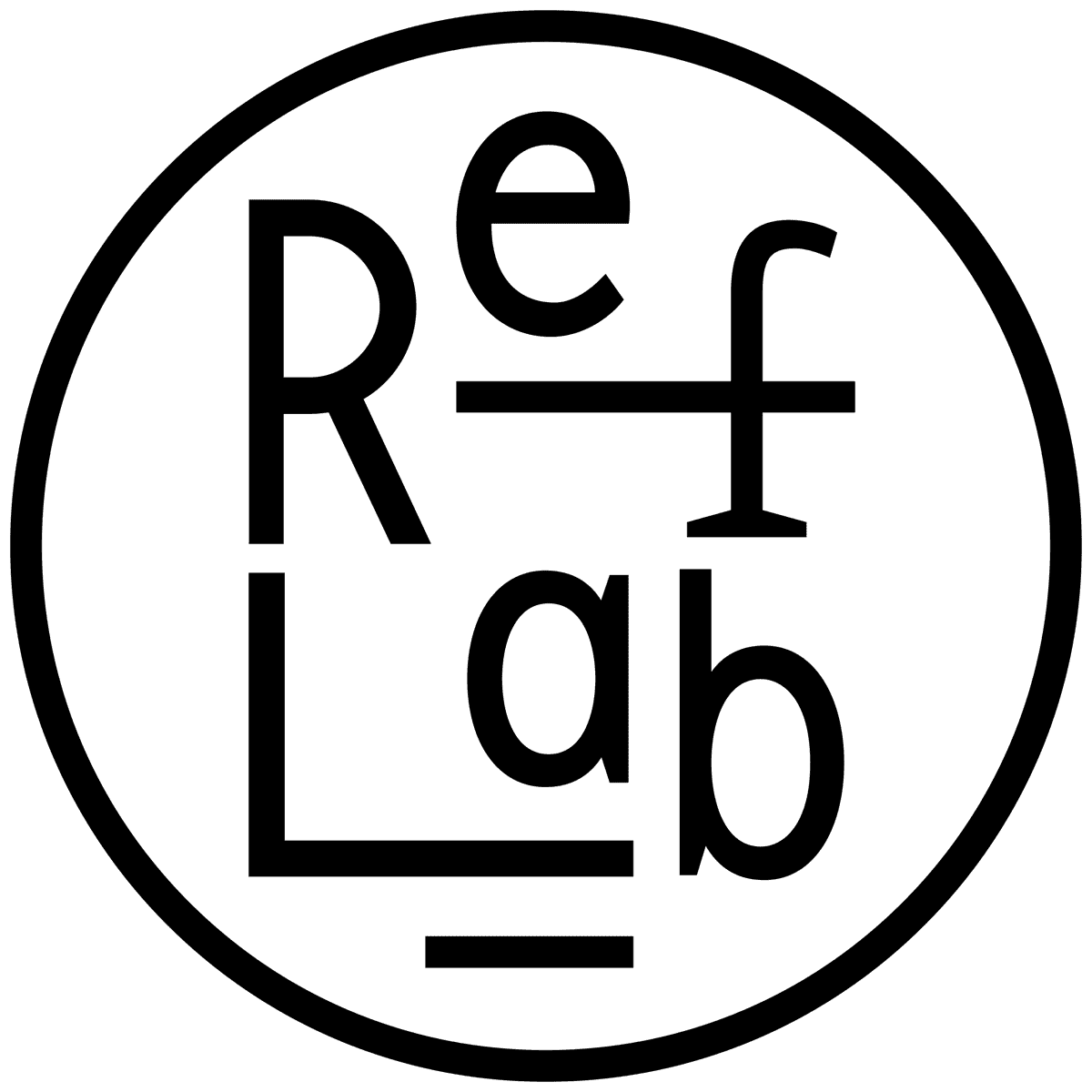







2 Gedanken zu „«Du nervst, aber ich habe dich gern»“
Es ist auch deshalb bemerkenswert, dass dieser Film von der Kirchenjury prämiert wurde, weil in ihm jegliche Transzendenz fehlt. Während letztes Jahr noch interreligiöser Ansätze vorkamen, fehlt bei den Mädchen und bei den Erzieher:innen jeglicher Bezug zu irgendeiner anderen Ebene als dem Diesseits. „Wir sind allein“ ist in der Tat ein Satz über die „conditio humana“. Was ist dann noch der Trost? Bei wem kann man noch „beichten“, die „Wahrheit“ sagen (Wahrheit oder Lüge, ein Spiel im Heim), oder gar Vergebung finden? Es geht nur untereinander, und nach dem erschütternden Bekenntnis der Direktorin bleibt einfach Schweigen. Aber reicht das nicht schon? Der Film ist theologisch interessant, weil in ihm Gott nur noch in der totalen Abwesenheit anwesend ist. Nur: lustig ist das nicht. Der Film schafft es trotz der spannenden nichtlinearen Erzählweise nicht, die Schwere wenigstens zwischendurch abzustreife. Auch Humor wäre eine Art Transzendenz – die letzte, die uns übrig bleibt?
Danke für diesen Kommentar und die Diskussionsanregung! Ich habe es nicht ganz so düster empfunden, sondern fand, dass zwischen den Menschen durchaus transzendierende Öffnungen auftauchen. Aber es stimmt, einen Jenseitsbezug gibt es nicht. Und die Bürde der sozialen Randständigkeit (ein Mädchen hat Flüchtlingsschicksal und soll abgeschoben werden, andere erlitten Vergewaltigung in der Familie) sowie relative Perspektivlosigkeit junger Menschen macht deprimiert.