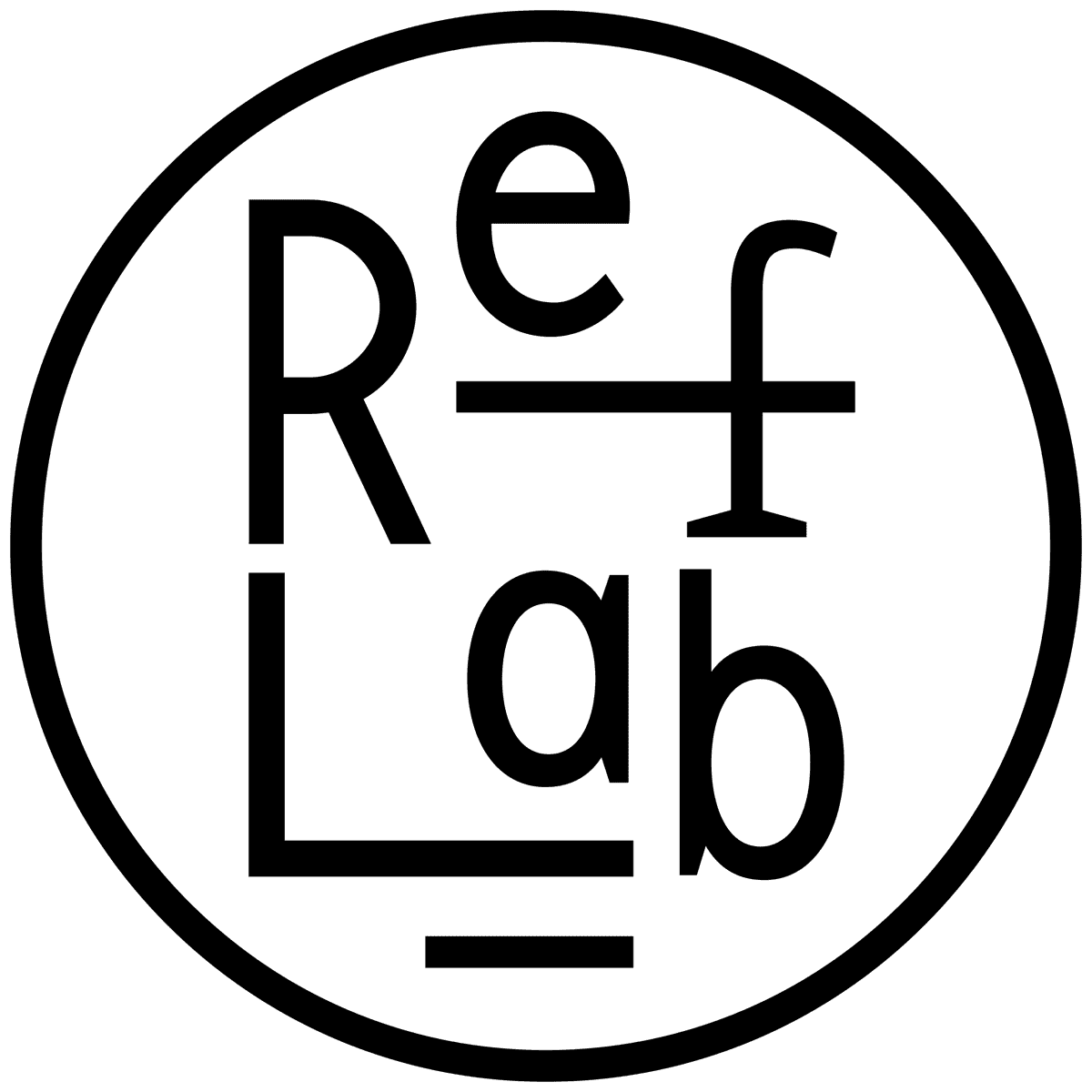Es gibt Dinge, die hält man für gut und richtig – und dennoch für verblasst oder langweilig. Das gilt etwa für Arbeiterkundgebungen, allen voran 1.-Mai-Feiern. Haftet ihnen heute nicht bestenfalls etwas Folkloristisches an? Wirken sie nicht wie eine Tradition, die man der Tradition willen begeht, ohne so recht daran zu glauben?
Und gilt das nicht sogar für das Wort «Solidarität», das die Arbeiter:innen zusammen führte, um gemeinsam gegen unmenschliche Arbeitsbedingen zu demonstrieren? Erscheint sie heute nicht häufig als abgegriffene Vokabel?
Versuchen wir uns zunächst noch einmal vor Augen zu führen, was das unbedingt Schöne und Gute an der Idee der Solidarität ist: Es ist das Einstehen für Schwache im gemeinsamen Starksein. Es geht bei der Solidarisierung nicht bloss darum, eigene Gruppeninteressen zu repräsentieren, sondern auch darum, sich für gerechte Ziele einzusetzen und dabei etwas zu riskieren. Darum, jenen Mutigen, die sich trauen, gegen Unrecht und Machtmissbrauch die Stimme zu erheben, beizustehen, statt sich wegzuducken. Jede:r, die/der eine solche Solidarisierung erfahren hat, weiss, wie wertvoll sie ist.
Wie also konnte Solidarität verblassen?
Als Erklärung lassen sich mindestens zwei Gründe anführen: Erstens der strukturelle Wandel der Gesellschaft von klassischer Lohnarbeit hin zu Angestelltenverhältnissen. Aus verschiedenen Gründen neigen Angestellte stärker zur Individualisierung. Dies hat schon Siegfried Kracauer in seinem Angestelltenbuch («Die Angestellten», 1930) festgestellt, einem Grundlagenbuch der Arbeitssoziologie.
Zweitens die neoliberale Transformation der Gesellschaft: Der Neoliberalismus machte, nicht ganz zu Unrecht, darauf aufmerksam, dass Arbeitnehmerrechte in Zeiten von Massenarbeitslosigkeit den Zugang zum Arbeitsmarkt erschwerten. Die Solidarisierung der Arbeitnehmer gegen eine «Flexibilisierung des Arbeitsmarktes» war richtig. Einerseits. Sie beinhaltete aber auch etwas Unsolidarisches gegenüber den Arbeitslosen. Sie war exklusiv.
Grundsätzlicher zeichnet das neoliberale Narrativ Angestelltenverhältnisse als langweilige und vor allem als unfreie Verhältnisse. Und propagiert demgegenüber den selbständig Tätigen, den freien Unternehmer als ihr Ideal.
Was in der Theorie super klingt, ist es in der Praxis häufig nicht. Ich habe beides erlebt: selbständige und angestellte Arbeitsverhältnisse.
Mein Boss war ich
Als Mikrounternehmerin, die im Selbstauftrag die eigene Schreibleistung vermarktete, begab ich mich nach dem akademischen Studium in Konkurrenz zu anderen Leistungsanbietern. Ich war also freischaffend oder man kann auch sagen: eine Ich-AG. Anfang der Nullerjahre kam diese sprechende Vokabel als Bezeichnung für ein Einzelunternehmen auf, das ein Arbeitsloser gegründet, um die eigene Zeit und Arbeitskraft zu vermarkten. Das Modell machte Schule.
Freischaffende kämpfen darum, möglichst verbindliche Kontakte zu einzelnen Auftraggebern aufzubauen. Bei der Steuererklärung müssen sie dann aber belegen, nicht abhängig, also scheinselbständig zu sein. Scheinselbständige sind vor allem von einem Unternehmen abhängig, jedoch ohne vom sozialen und rechtlichen Schutz des Arbeitnehmers zu profitieren und ohne das soziale Prestige von Unternehmern oder Künstlern zu geniessen.
In den 2010er Jahren, ich war inzwischen Redakteurin in einem grossen Medienkonglomerat mit einer Millionenleserschaft, also angestellt, sagte man uns:
«Ihr seid frei. Ihr könnt machen, was ihr am besten könnt.»
Es klang zunächst super. Niemals aber erlebte ich eine schärfere Konkurrenzsituation am Arbeitsplatz als damals. Zeitgleich liefen sogenannte Change Massnahmen, auf klardeutsch: Rationalisierungen, Outsourcing, Personaleinsparungen.
Die Verbindung der Nachteile beider Modelle
Ich verkörperte damals einen neuen Arbeitstyp, für den ich noch keinen Namen hatte. Ich war, wie mir später klar wurde, «Arbeitskraftunternehmerin». Dabei fliessen die Modelle von angestellt und selbständig in Formen selbständiger Abhängigkeit zusammen. Es verbinden sich hier tatsächlich die Nachteile beider Modelle: des Selbständigen (totale Unsicherheit) und des Angestellten (weitgehende Unfreiheit).
Man ist ein Lohnarbeiter ohne fest umrissenen Arbeitsauftrag, der seinen Platz im Unternehmen täglich neu erobern und gegenüber Mitkonkurrierenden behaupten muss. Und der immer wieder neu demonstrieren soll: Gerade auf mich kann das Unternehmen nicht verzichten!
Die Atomisierung wächst und die Desolidarisierung spitzt sich natürlich zu, wenn Arbeitnehmer:innen um die eigenen Jobs kämpfen müssen.
Der Begriff des Arbeitskraftunternehmers stammt von den Soziologen G. Günter Voß und Hans J. Pongratz. Sie identifizierten und beschrieben in den Nullerjahren diesen Typus von Arbeitskraft, der genötigt ist, mit seiner eigenen Arbeitskraft wie ein Unternehmer umzugehen. Die Soziologen beschrieben diese Form bezeichnenderweise im Zusammenhang mit Burnout-Studien.
Überforderung und Selbstausbeutung liegen dort besonders nahe, wo Menschen für etwas innerlich brennen und gleichzeitig der äussere Druck wächst. Das traf in den zurückliegenden Jahren und Jahrzehnten in hohem Mass bei Sozial- wie auch bei Kreativberufen zu.
Das neoliberale Job-«Wunder»
Die Ausweitung der Prekarisierung der Arbeit ist keine zufällige Entwicklung, sondern sie wurde vielerorts bewusst vorangetrieben: im Kontext der sogenannten neoliberalen Wirtschaftsordnung – und mit einer Rhetorik der Gerechtigkeit, ja Solidarität. Um den Arbeitsmarkt «durchlässiger» zu gestalten, wurden etwa im Zuge der Umsetzung der deutschen «Agenda 2010» einschneidende Aufweichungen des Arbeitsrechts als unumgänglich propagiert.
Im Zentrum der «Agenda 2010» standen umfassende Reformvorschläge für den Arbeitsmarkt und das Sozialsystem mit den erklärten Zielen «Verbesserung der Rahmenbedingungen für mehr Wachstum und für mehr Beschäftigung» sowie «Umbau des Sozialstaats und seine Erneuerung». Erreicht wurde tatsächlich ein signifikanter Rückgang der Arbeitslosenquote, allerdings um den Preis des Bedeutungsverlustes sogenannter «Normalarbeitsverhältnisse».
Reform gegen unten
Hatten Anfang der 1990er Jahre noch rund zwei Drittel der Erwerbstätigen in Deutschland ein unbefristetes, vollzeitnahes Beschäftigungsverhältnis ausserhalb der Zeitarbeitsbranche, waren es zuletzt nur noch etwas mehr als die Hälfte. Die umgekehrte Entwicklung zeigt sich bei der Niedriglohnbeschäftigung und atypischen Erwerbsformen, die stark zunahmen (Zeitarbeit oder Minijobs).
In der Schweiz stellt sich die Situation etwas anders dar. Eine von vornherein starke liberale Grundtendenz in Verbindung mit extrem ungerechter Vermögensverteilung ging hierzulande einher mit Massnahmen und effektivem gewerkschaftlichen Druck, was massives Lohndumping bisher verhindern konnten.
Exklusive Solidarität und Rechtspopulismus
Nun ist es bei näherem Besehen nicht so, dass die Bereitschaft zur Solidarität generell abgenommen hätte. Eine bestimmte Solidarität nimmt sogar wieder zu. Die Soziologin Alexandra Schauer beschreibt diese in einem «Zeit»-Interview («Es gelingt nicht mehr, ein gemeinsames Bewusstsein zu entwickeln») als exklusive Solidarität. Hier ist kennzeichnend, das bestimmte Ansprüche nur für einzelne Gruppen eingefordert werden.
Ausdruck einer exklusiven Solidarität ist nach Schauer der Rechtspopulismus.
Bereits Siegried Kracauer beobachtete in den 1920er-Jahren eine Gleichzeitigkeit von Individualisierung und Vergemeinschaftung, also in der Phase des aufkeimenden Faschismus. Für Angestellte sind laut Schauer damals wie heute starke Selbstwirksamkeitsideale, ausgeprägter Individualismus und meritokratisches Denken kennzeichnend, wonach es eigentlich nur darauf ankomme, durch eigene Leistung sozial aufzusteigen. Weil jedoch inzwischen die Vorstellung fehle, «dass es grundsätzlich besser und anders werden könnte, werden Verteilungskämpfe immer aggressiver ausgefochten».
Gerade dies, so lässt sich folgern, macht das Zusammen- und Einstehen in Form inklusiver Solidarität umso notwendiger. Und der erste Schritt dazu ist eine Besinnung darauf, was echte Solidarität ist: Sie ist weder die wohlfeile Fernsolidarisierung durch Lippenbekenntnisse noch eine Scheinsolidarisierung auf Kosten der Schwächeren. Sondern die mutige Bereitschaft der Unterstützung eines Kampfes gegen Unrecht.
Foto: Ant Rozetsky auf Unsplash.