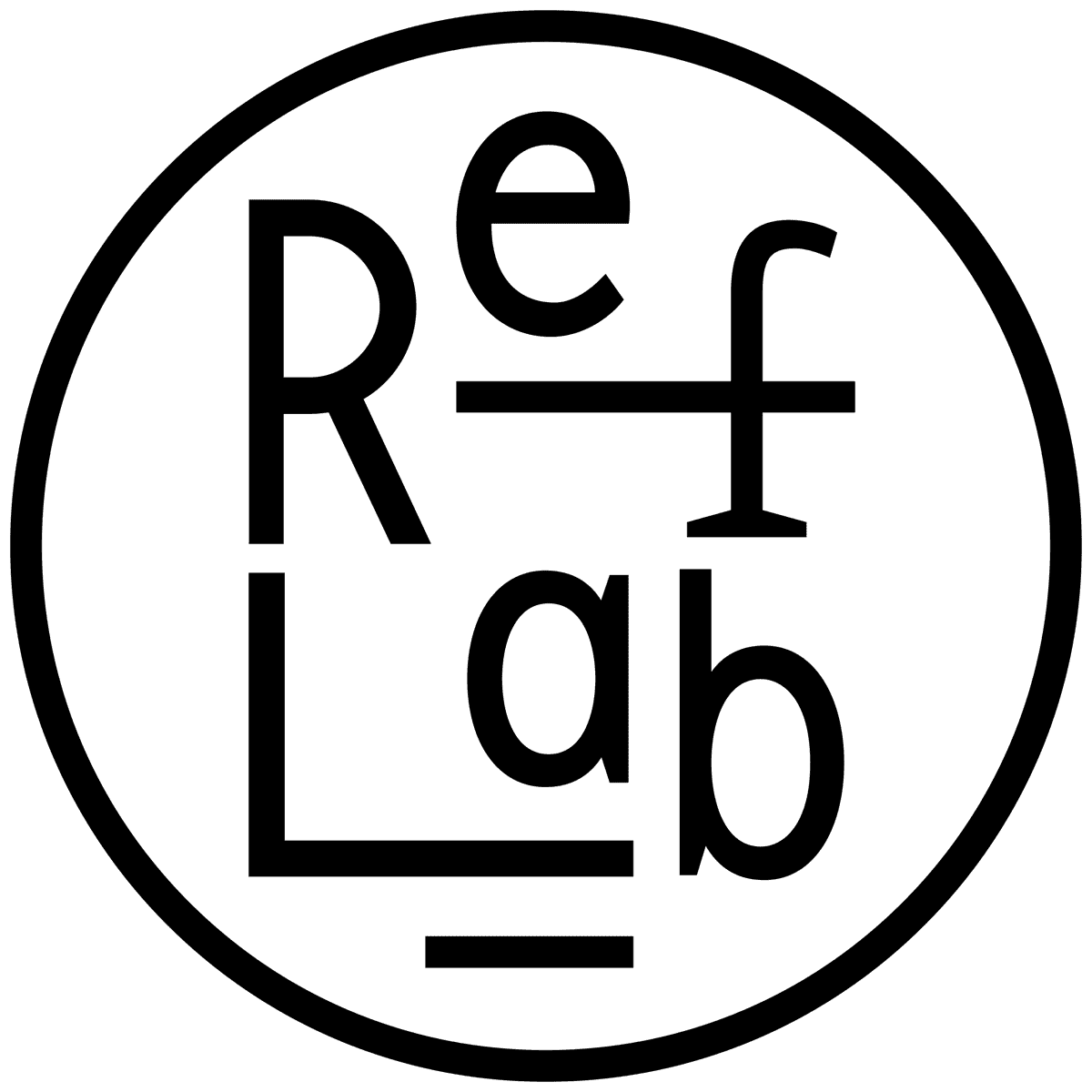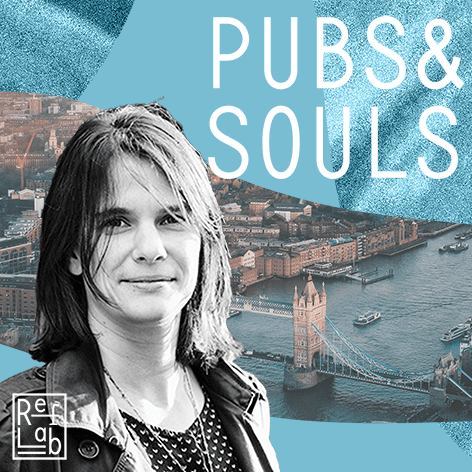Ich würde ja von mir behaupten, ich besitze nicht viele Dinge. Bücher zum Beispiel habe ich noch etwa zehn. Alle anderen sind weitergegangen. Mein Keller war leer und die Estrichkämmerli unter dem Dach so gut wie. Dennoch:
Wenn du damit beginnst, dein Hab und Gut in Kisten zu verstauen, merkst du schnell, wieviel es letztlich doch ist.
Alleine meine Küche brauchte öppe sieben Kisten. Selbst nach radikalem Marie-Kondo-ing. Und ich hatte eine kleine Küche. Wow.
Wie alles begann: ein Gang in den Estrich
Der Prozess des Aussortierens und Loswerdens begann, noch bevor ich überhaupt wusste, dass und wohin ich umziehen werde. Ich glaube, der Auslöser war, dass ich eine verschliessbare Kiste für meine wollenen Pullis und Socken wollte, damit die sicher übersommern können. Mein verstorbener Partner hatte solche und so schaute ich bei seinen Dingen nach, die auch nach all den Jahren noch in meinen Estrichkämmerlis sassen.
Aus dem «schnell eine Kiste holen» wurde ein sehr emotionaler Ablösungsprozess – der auch im Loslassen der letzten seiner Dinge gipfelte.
Einiges ging zu seiner Mutter und Schwester, anderes behielt ich, weil Wegwerfen falsch gewesen wäre. Doch dazu später.
Nach diesem ersten Ausmisten fand ich mich inmitten von Stapeln von Dingen wieder, die nicht bei mir bleiben wollten. Und als klar wurde, dass ich tatsächlich umziehe, war ich entschlossen, so wenig wie möglich mitzunehmen. Zur Inspiration schaute ich mir einige Marie-Kondo-Episoden auf Netflix an und merkte:
Bei Briefen und Fotos hatte ich mir bisher nie die Frage gestellt, ob ich die tatsächlich behalten möchte – sie waren selbstverständlich geblieben. Und so ging ich jetzt jedes Foto in jedem Album durch und und fragte mich, bringt mir dieses Foto Freude? Dieser Brief?
Was tun mit Sentimentalem?
Bereitet mir das Objekt Freude? Die Antwort lautete meistens: Nein.
Nicht weil ich Erinnerungen verdrängen wollte oder Kapitel aus meinem Leben löschen, gar nicht. Aber es wurde so deutlich, dass die Erinnerung, die Erfahrung nicht in diesen Briefen, in diesen Fotos oder im Teetassli eines geliebten Menschen steckt.
Liebe ist nicht an Gegenstände gebunden.
Wenn das Teetassli also eher schwer wiegt, muss ich es nicht behalten. Es darf gehen. Wenn mich ein Foto aber freut und leicht und lichtvoll ist, darf es bleiben. Ich brauche nicht die Briefe, um zu wissen, wie sehr ich geliebt worden bin. Das Wissen ist da, Punkt.
Es war gleichzeitig auch ganz klar: Diese Briefe, Fotos, ja Kleidungsstücke meines Partners, die landen nicht im Abfall. Dafür braucht es ein Ritual, eine Zeremonie. Ein Feuer. Und so wartete ich auf den richtigen Moment, um mit meinem Säckli voller Erinnerungsstücke in den Wald zu gehen und sie zu verbrennen. Geschehen ist es letztlich an einem unspektakulären Nachmittag, ich alleine, Stück für Stück ging ins Feuer. Und es fühlte sich unendlich befreiend an.
Behalten muss ich nichts. Rein gar nichts.
Das Wissen darum, was war, bleibt. Unabhängig davon, ob es auf einem Stück Papier steht oder ich ein Foto als Beweis habe.
Was, wenn du es mal bereust?
Klar, die Möglichkeit besteht, dass ich mich irgendwann nicht mehr erinnern kann. Dass mein Gehirn nicht mehr so gut mitmacht, vielleicht weil ich hochbetagt bin, vielleicht weil ich krank bin. Doch das weiss ich jetzt noch nicht, kann ich nicht wissen, muss ich nicht wissen. Was ich jetzt weiss ist:
Es fühlt sich gut an, ohne Ballast unterwegs zu sein.
Was mir Freude bereitet, durfte bleiben. Was schmerzt, durfte gehen. Ich muss meine Geschichte nicht festhalten, denn das fühlt sich wenig frei an. Mich darüber zu definieren, was einmal war, limitiert mich. In dem Sinne, dass ich Offenheit vermisse für Anderes, Überraschendes. Ich kenne mich dann immer nur so, wie die Vergangenheit mich zeichnet.
Die Realität ist da viel kreativer, sie bietet viel mehr Raum für Veränderung und Entfaltung. Ich ziehe die Realität dem begrenzten Projizieren der Vergangenheit auf die Zukunft allemal vor.
Insofern: Behalten muss ich nichts. Und das ist ein gutes Gefühl.
Photo by Kelly Sikkema on Unsplash