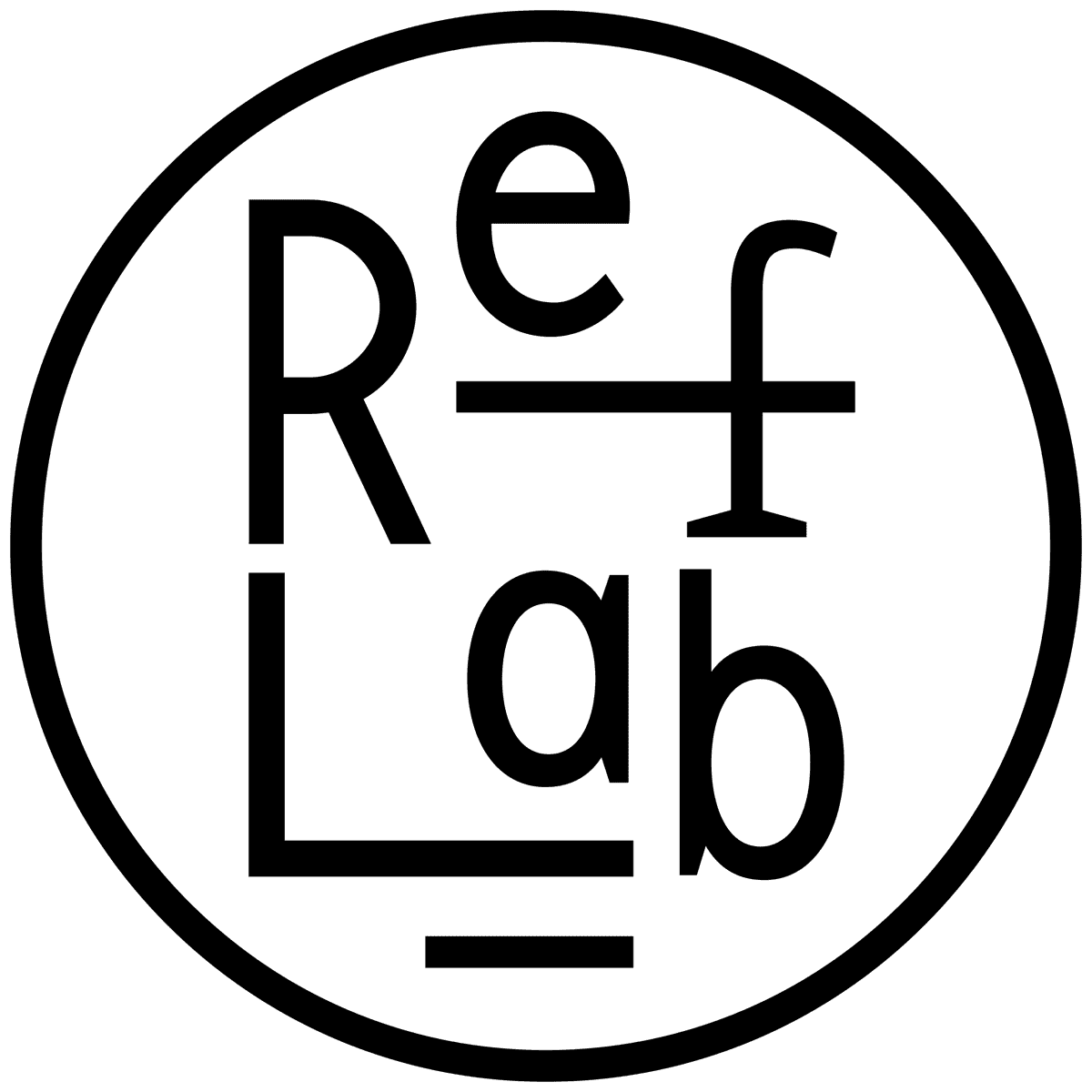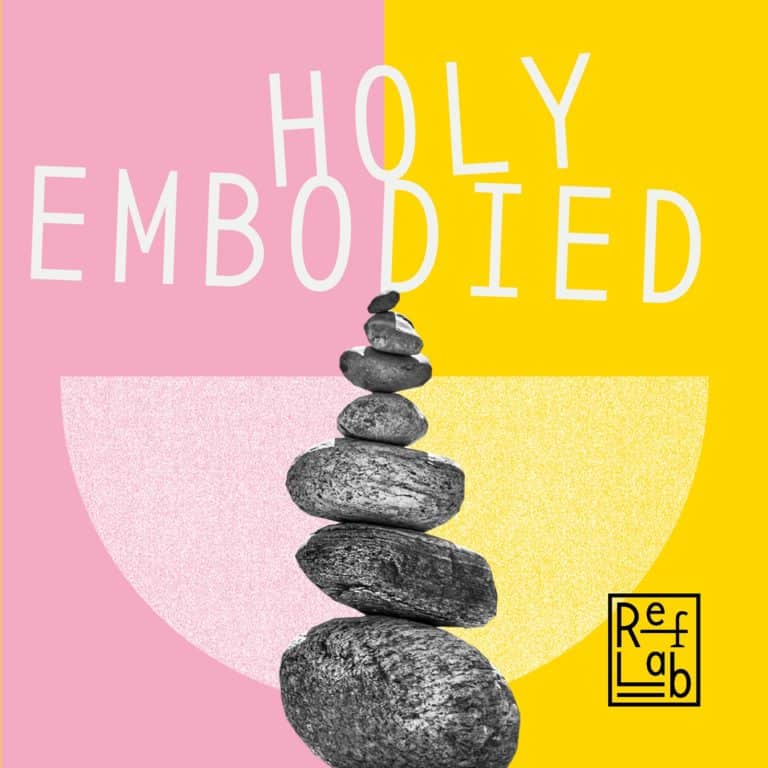Über Bademeisterinnen existieren zwei Klischees: Entweder sie hechten in leuchtendroter Kleidung sexy ins Wasser und retten Menschen vor dem nahen Tod. Oder dann sitzen sie den ganzen Tag an der Sonne und tun, genau: nichts.
Fabienne arbeitet seit sieben Jahren als Bademeisterin. Wieviel diese Klischees mit der Realität zu tun haben, und was sich in einigen Zürcher Freibädern tatsächlich so alles abspielt, erzählt sie in dieser Sommer-Kolumne.
Da Badis sensible Orte sind, wurden die Angaben zu Gesprächen und Erlebnissen verfremdet. Manches ist genau so geschehen, manches nicht ganz.
Betrunkener Gast aus dem FKK-Bereich
An einem Abend hatten mein Kollege und ich gerade eine chemische Grundreinigung von Dusche und Toilette gemacht. Mit Gummistiefel, Handschuhen und Schutzbrille kamen wir aus dem Putzraum, als ein Mann vor uns stand. Er war splitterfasernackt.
Vermutlich kam er vom FKK-Bereich nebenan. Er war sehr betrunken und suchte die Toilette.
Wir bugsierten ihn hinaus und er hoppelte nackt über die Wiese zurück. «Also so etwas habe ich noch nie gesehen!«, grinste ich. »Du meinst, so einen Kleinen hast du noch nie gesehen!», meinte der Kollege.
Ich seufzte.
Das Politikum der Nacktheit
Sobald es um Nacktheit geht, sind Haltungsfragen zu Körper- und Genderthemen natürlich nicht weit. Mal mehr und mal weniger direkt wird das Aussehen einer Person be- oder verurteilt.
Jede sogenannte «Nichtpassung» zur erwarteten, aber real nicht vorzufindenden Schönheitsnorm wird registriert. Zu viel Haut/Fett/Haare, zu wenig von davon oder am falschen Ort: Alles wird zum Politikum.
Kein Wunder, sind viele Menschen maximal verunsichert, wenn sie in die Badi kommen.
Damit kommen wir zu einem weiteren Politikum, das ich für weitaus brisanter halte als die Frage, wie man um Himmels Willen das Mann-Frau-Garderobensystem auflöst, damit trans und nichtbinäre Menschen unaufgeregt baden können. (Spoiler: Es wär imfall nöd so schwierig.)
Es geht um den fehlenden Konsens bei Nacktheit.
Ich wundere mich jedes Mal, wie viele Menschen es für eine gute Idee halten, halbnackte Menschen ohne ihr Einverständnis zu fotografieren und auf Social Media hochzuladen. Blauäugig knipsen sie eine Wiese, auf der Menschen praktisch in Unterwäsche daliegen.
Nacktheit braucht Konsens!
Oft gehen wir naiv davon aus, dass niemand eine böse Absicht hat. Und es stimmt zum Glück: Häufig überlegen sich Menschen herrlich wenig. Wenn ich ihnen erkläre, dass manche schon Fotos für pädophile Zwecke gemacht hätten, macht es schnell Klick.
Badis müssen sicher sein
Badis müssen ein Safe Space sein, bei der die körperliche Unversehrtheit gewahrt wird. Warum sollte es okay sein, Fremde in unseren Stories zu präsentieren, wenn wir nicht einmal Freund:innen erlauben, die gemeinsamen Badibilder zu posten oder als Profilbild zu nehmen?
Im öffentlichen Raum braucht es mehr als nur den Konsens von zwei Menschen, sondern aller, die möglicherweise auf den Bildern erscheinen.
Dass es nicht nur den Konsens der direkt Beteiligten braucht, gilt auch für Sex an öffentlichen Orten.
Für mich sind es zwei Paar Schuhe, ob ich meinen Nachbarn und seine neue Freundin morgens um halb zwei eine Wohnung weiter glücklich stöhnen höre, oder ob ich Menschen beim Sex auf der Toilette vorfinde.
Mein persönliches Verständnis, weshalb Kabinen, in denen Menschen ihre Därme entleeren, als passender Ort für Zärtlichkeiten gesehen werden, hält sich ohnehin in Grenzen. Da geht es nicht um moralische Spiessigkeit, sondern darum, dass Körperlichkeit etwas Vielschichtiges ist, bei dem Grenzen sehr unterschiedlich gesteckt sind.
Die «chibsche Studentin»
Vielleicht bin ich auch deshalb in der Badi zur Feministin geworden. «Schuld» daran ist ein Stammgast.
A. war ein kettenrauchender, pensionierter Mann aus dem Balkan, der mich «die chibsche Studentin» nannte. «Die hübsche Studentin» war ich auch auffällig oft für andere Badegäste.
Mir war es ein Rätsel: War hübsch eine besonders wichtige Rettungskompetenz?
Manchmal täuschten männliche Badegäste vor, einen Krampf zu haben, damit ich sie rettete. Eines Tages beschwerten wir Frauen uns bei den Arbeitskollegen darüber. Sie verstanden nicht:
«Vor uns ziehen sich auch Frauen aus, wenn wir die Toiletten kontrollieren», meinten sie. Oder «Seid froh, dass ihr jung und schön seid. Ab 50 geht alles sowieso nur noch den Bach runter!» Ja logisch, dachte ich bei mir – wenn man alles auf die Karte der jugendlichen Schönheit setzt oder nur darüber definiert wird.
Der Stammgast, der mich zur Feministin machte
In anderen Fällen meinte ein weiblicher Gast, ich als Frau sollte doch die Halterung fürs Rettungsbrett nicht an die Wand schrauben, das sei ein Männerjob. Bei den Eingangskontrollen während Corona marschierten Menschen an mir vorbei, als würde ich nicht existieren, obwohl ich genauso aufrecht vor dem Eingang stand wie meine 1,85m-Kollegen.
Ausserdem bekam ich als Frau aggressive Beschwerden zu den unsinnigsten Dingen. Wenn ich den Kollegen davon erzählte, wunderten sie sich. Das hätten sie noch nie erlebt. Oder sie meinten manchmal: «Sei ein bisschen netter. Lächle doch mal!»
Wie sollten sich auch verstehen? Badegäst:innen begannen ja schon, sich zu rechtfertigen, sobald sie – meine Kollegen – sich mit strengem Blick die Sonnenbrille von der Nase schoben.
Da kam A., der kettenrauche Stammgast, sehr gelegen.
Ich war gerade in der Aufsicht, als er begann: «Ich habe dieses Buch der Journalistin Michèle Roten gelesen», meinte er. «Es heisst ‘Wie Frau sein‘.» – «Ohh, klingt doch spannend.» A. monierte: «Diese Roten ist mir zu links-grün versifft.»
Am Abend fischte ich das Buch aus der Bibliotheks- und Tauschkiste.
Bis dahin hatte ich mich nie als Feministin bezeichnet. Aber Michèle Roten schrieb auf eine Weise über Feminismus und das Problem mit dem Feministinnen-Label, mit der ich mich sofort identifizieren konnte. Sie gab mir Worte für Erlebnisse und es dauerte nicht mal die Hälfte der Lektüre, bis ich mich Feministin nannte.
Dreckige Toilette gegen Mülleimer
Feministische Konzepte zu kennen, hilft, wenn man mal wieder aushandeln muss, wer Toilette mit dem blutigen Tampon oder den Durchfallspuren reinigen muss. Dreckige Toilette gegen mühsames, übervolles Mülleimer-Leeren um 17:30, so sieht es aus.
Ich wehre mich, wenn ich die dreckigen Unterhosen der Kollegen waschen soll im Namen von «Wir sind doch ein Team».
Sie würden dafür, ja was genau tun? Einfach ihren Job, den sie als Grosszügigkeit verkauften?
Arbeitsteilung statt Klischees
Logisch: Nicht immer sind patriarchale Prägungen ein Grund für ein bestimmtes Verhalten von Gäst:innen oder Kollegen. Und logisch: Für einige Kollegen ist das alles keine Frage.
Da starte ich die Wäsche mit den Putzlappen, weil ich halt grad dran denke, und sie tragen die schweren Sonnenschirme in die Garage. Oder sie spülen das Geschirr und ich reinige die Aschenbecher.
In manchen Fällen schicken sie mich zu einem Konflikt, weil ich aufgrund meiner Erscheinung weniger bedrohlich wirke. Manchmal ziehen sie los. Manchmal ist es egal.
Das hat nichts mit Klischees zu tun, sondern mit Arbeitsteilung.
Am Abend machen wir immer noch gemeinsam Arschbomben vom Sprungturm, wenn uns niemand mehr beobachtet. Denn am Ende sind wir nur so gut, wie wir es als Team sind. Aber das habe ich ja bereits geschrieben.
Illustration: Rodja Galli