Über Bademeisterinnen existieren zwei Klischees: Entweder sie hechten in leuchtendroter Kleidung sexy ins Wasser und retten Menschen vor dem nahen Tod. Oder dann sitzen sie den ganzen Tag an der Sonne und tun, genau: nichts.
Fabienne arbeitet seit sieben Jahren als Bademeisterin. Wieviel diese Klischees mit der Realität zu tun haben, und was sich in einigen Zürcher Freibädern tatsächlich so alles abspielt, erzählt sie in dieser Sommer-Kolumne.
Da Badis sensible Orte sind, wurden die Angaben zu Gesprächen und Erlebnissen verfremdet. Manches ist genau so geschehen, manches nicht ganz.
Sexyness nicht auf Level Baywatch
«Wir sind die Badeenten in Gelb», sagte ich für gewöhnlich Freund:innen, wenn sie in die Badi kommen. Von Bademeister:innen der Stadt Zürich ausgesucht – so jedenfalls lautet die Geschichte, die mir seit einigen Jahren erzählt wird – signalisiert die Farbe höchste Sichtbarkeit.
Kein Wunder. Kommt ja sonst kaum jemand freiwillig auf die Idee, in sonnengelben T-Shirts durch die Gegend zu laufen. Dazu gibt es die engsten und unbequemsten Bermuda-Shorts, die ich kenne. Immerhin in Schwarz, mit Sportamt-Logo. Aber trotzdem.
Das Sexyness-Level liegt gefühlt unter Null.
Bei mir sowieso: Ich trage, wie so einige meiner Kolleginnen, die «Männer»-Version des Entenshirts.
Einerseits sitzt es loser, was bei Hitze angenehm ist. Andererseits, und das hat nichts mit Schutz vor blöden Blicken zu tun, ist der Ausschnitt rund. Ich verbrenne mir die empfindliche Haut am Dekolleté nicht.
Denn die Tage am Wasser sind lang. Die reine Arbeitszeit beträgt an einem schönen Tag locker 12 Stunden. Mit Pausen und Umziehen sind wir bis zu 14 Stunden präsent. Da braucht es guten Sonnenschutz.
Es gibt jedoch so einige Badegäst:innen, die bezweifeln, ob es unsere Präsenz überhaupt braucht. In harmlosesten Dingen sehen wir Katastrophen, verderben jeden Spass, und früher, «Ja da schlief der Bademeister bis mittags und seine Mutter schaute vom Kiosk aus übers Wasser», hat mir mal eine Stammgästin erzählt.
Moralhüter im Bad
Ganz so genau stimmt das nicht. Sicher, früher gab es sehr viel weniger Regelungen.
Die Schweizerische Lebensrettungsgesellschaft gründete sich 1933. Vieles über Faktoren, die das Risiko von Ertrinken senken oder erhöhen, war noch nicht bekannt. Wenn wir heute sagen, dass Menschen bitte nicht unter einem Steg tauchen sollen, hat das vor einigen Jahrzehnten noch kaum jemanden interessiert.
Doch Baden war insbesondere moralisch stark reglementiert. Noch mein Grossvater wuchs in einem Dorf am Bodensee auf, das lange eine geschlechtergetrennte Badi hatte. Daher badete er als junger Mann in der Nachbarstadt.
Meine Grossmutter, in Luzern am Vierwaldstättersee gross geworden, ging als Kind mit ihrer Familie nicht ins 1929 eröffnete Lido:
«Das machte man einfach nicht.»
Und mancherorts, wie beispielsweise im Gartenbad Allenmoos in Zürich, das 1939 eröffnet wurde, war Baden eine feine Angelegenheit. Nach dem Eintritt musste man an einer bedienten Garderobe Kleidung und Schuhe abgeben und durfte den Rasen nur barfuss betreten.
Ein Moralhüter in Weiss wachte darüber, dass es auf der Wiese sittlich zu und her ging. Jemanden «des Bades zu verweisen», wie das im Badereglement formuliert war, war eine durchaus gängige Praxis.
Knutschen auf dem Tüechli
Heute knutschen Menschen bedenkenlos auf dem Tüechli und wundern sich ob der vielen Sicherheitsvorkehrungen. Warum braucht es überhaupt Bademeister:innen? Geht doch auch bestens, wenn nicht besser ohne sie.
Und ganz genau so sollte es sein. Menschen denken fälschlicherweise, dass wir erst dann arbeiten, wenn wir ins Wasser springen oder mit Notfallrucksack über die Anlage hechten. Doch unsere Hauptaufgabe ist Prävention.
Wir machen gerade dann unsere Arbeit besonders gut, wenn wir mit unseren Luchsaugen dafür sorgen, dass Dinge gar nicht erst geschehen.
Alles ist gut, wenn es langweillig ist. Alles ist gut, wenn Menschen denken, dass es uns nicht braucht.
Bei Badegäst:innen führt das meist zur umgekehrten Wahrnehmung, dass wir viel zu pingelig sind. Und sicher, man kann darüber streiten, ob jetzt jemand sein Tüechli in einer vollen Badi aus dem Weg räumen muss, damit wir für den Fall der Fälle eine Rettungsgasse haben.
Doch mir persönlich ist es lieber, wenn Menschen ihre schlechte Laune an mir auslassen, wenn ich ihnen etwas verbiete. Denn im Ernstfall reden sie womöglich gar nicht mehr mit mir. Sei es, weil jemand vom Steg aus auf sie gesprungen ist, oder weil jemand auf die gloriose Idee kam, das Velo vor der Rettungsleiter zu parkieren und wir wertvolle Zeit bei der Rettung verlieren.
Frustmanager:innen in Gelb
Daher bin ich lieber die unsympathische Spassverderberin. Immerhin werde ich ja dafür bezahlt, mit den vielseitigen Emotionen von Menschen klarzukommen.
Im ganz banalen Bademeister:innen-Alltag könnte meine Jobbeschreibung daher auch lauten: «Frustmanagerin in Gelb».
Dass das die billigste und beste Version für Steuerzahlende ist, muss allerdings noch etwas in den Köpfen ankommen: Nicht selten kommen Menschen zu mir in die Aufsicht und behaupten – ganz besonders, wenn ihnen etwas nicht passt – an mir seien ihre Steuergelder verschwendet.
Doch das Gegenteil ist der Fall.
Wir sind noch das günstigste Glied der Rettungskette.
Richtig teuer wird es ja erst, wenn wir die Wasserpolizei oder weitere Blaulichtorganisationen für eine Rettung aufbieten müssen.
Wenn ihr also das nächste Mal in der Badi seid und euch darüber aufregt, dass ihr euer zwei Meter hohes Einhorn nicht aufs Wasser nehmen dürft, damit wir Bademeister:innen das Wasser besser überblicken können, denkt daran: Es kommt für alle Steuerzahlenden günstiger. Das Einhorn könnt ihr auch ganz leicht abseits von der Badi einwassern.
Illustration: Rodja Galli
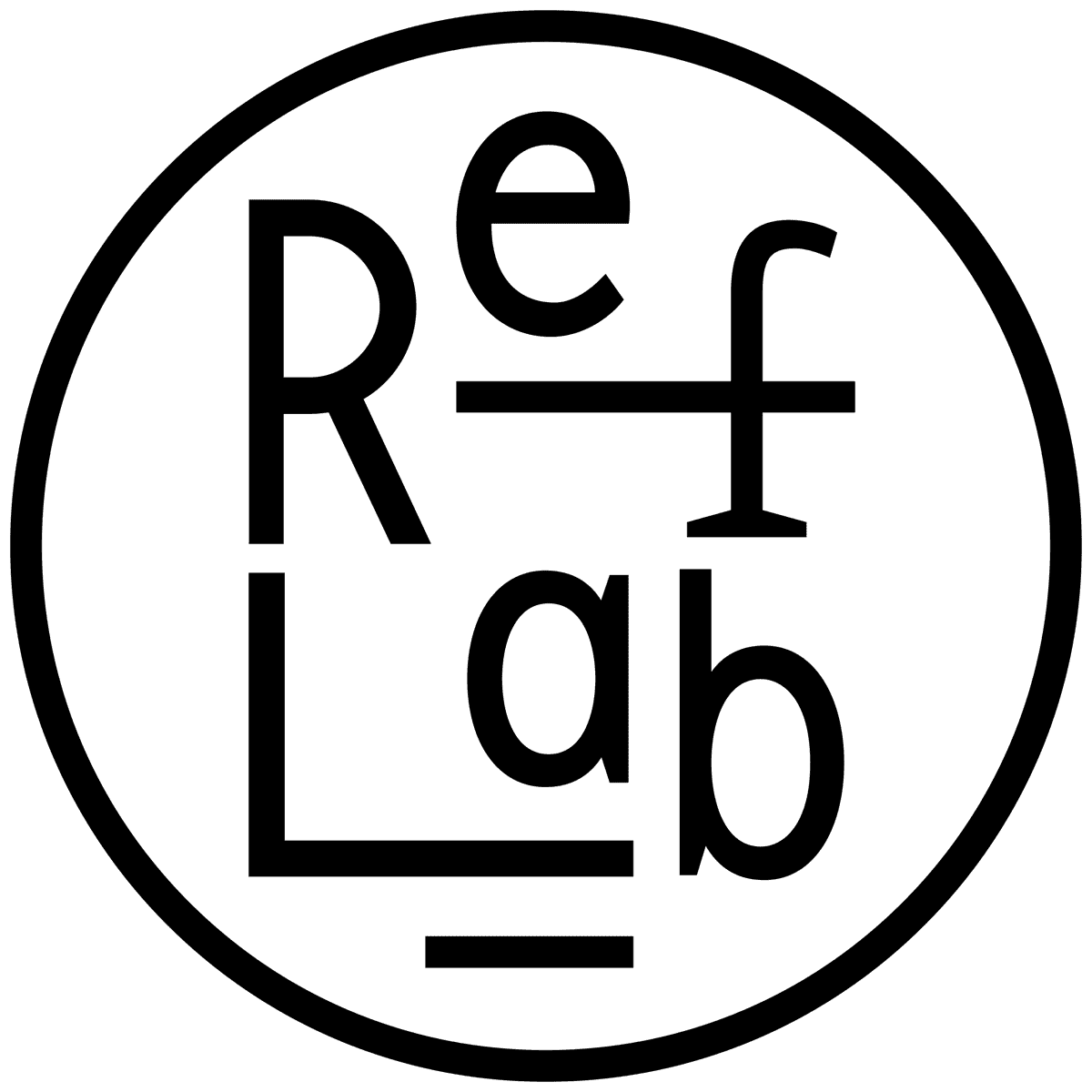





1 Gedanke zu „Badi-Kolumne, Teil 1: Langweilig heisst, alles ist gut“
Braucht sicher entsprechendes Fingerspitzengefühl, ob das Durchsetzen der Regeln über den Dialog besser funktioniert oder ob ziemlich klar die Grenzen aufgezeigt werden müssen.
Respekt, dass du dich da engagierst 👍