Atmen, so meine Überzeugung, das kann ich. Mit mehr als 15 Jahren Yoga im Gepäck haben sich einige Stunden an Pranayama – das sind yogische Atemübungen, oder wie man heute gerne sagt: breathwork – angesammelt.
Für mich ist es das Normalste der Welt, meinen Atem wahrzunehmen, ihn tief im Bauch zu spüren und meist durch die Nase zu atmen. Ja, ich klebe mir sogar seit Jahren den Mund beim Schlafen zu!
Ich habe also grossen Spass daran, allerlei Kapriolen mit meinem Atem zu vollbringen, etwa meine Ohren mit den Daumen zu verschliessen und beim Ausatmen zu summen (Brahmari, eine sehr schöne Pranayama-Übung, auch für Anfänger:innen geeignet). Atempausen, Hyperventilation und so weiter sind nichts Fremdes – und doch, meine Beziehung zu Pranayama hat sich über die Jahre stark verändert.
Skeptisch gegenüber «breathwork»-Workshops
So auch mein Interesse, Pranayama zu unterrichten. Zunächst hatte ich grosse Freude daran, allerlei Techniken weiterzugeben.
Den so genannten «breathwork»-Workshops stehe ich dennoch eher skeptisch gegenüber. Oft nehme ich entweder kollektive Trance oder so ein «wir sind harte Kerle»-Vibe wahr. Atemreisen zu psychedelischen Videoprojektionen oder Hyperventilieren vor dem Bad im Eiswasser, aso ich weiss nöd.
Und als ich im ansonsten sehr lesenswerten Buch von James Nestor bei der Passage ankam, wo er CO2 einatmete und mit intensivsten Erstickungsgefühlen konfrontiert war, war klar – das ist mir alles viel zu extrem. Auch wenn dabei physiologisch gesehen alles im grünen Bereich bleibt, meine Amygdala [1] deräwäg go gusle, das scheint mir wenig liebevoll im Umgang mit mir selbst.
Vielleicht ist es sinnvoll für Menschen, die ohne jegliche Traumata im System unterwegs sind, so tiefer ins parasympathische Nervensystem zu kommen. [2]
Da das ist bei den wenigsten von uns der Fall, interessiert es mich viel mehr, das Gefühl der Sicherheit im Körper zu vertiefen, statt umgekehrt.
Und so tendiere ich heute eher dazu, den Atem sein zu lassen, ihn nicht künstlich zu manipulieren. Sondern eher damit zu spielen, wie und wo er sich im Körper ausbreiten kann, ob und wie der Atem eventuell tiefer, voller werden kann.
Atmen: simpel, nicht einfach
Ich komme mehr und mehr weg von diesen «Übungen», hin zu einem Entdecken der authentischen Bewegung – sei das im Atem, im Körper oder in der Seele. Was nicht in einem lethargischen Abgeschaltetsein endet, sondern in einem ausgefüllten Lebendigpräsentsein. Simpel, nicht einfach.
Oftmals stellen sich diverse Abwehrmechanismen in den Weg, die lieber «etwas tun» möchten, statt sich hinzugeben.
Ja, die Hingabe ist keine attraktive Praxis. Sie hat so wenig mit mir zu tun, ich kann da keine Auszeichnungen gewinnen und kann auch schlecht messen, wie gut ich bin. Diese Kategorie macht im puren Sein auch keinerlei Sinn, gut, schlecht, alles einerlei.
Atem anhalten, bis es nicht mehr geht?!
Trotzdem ging ich kürzlich in ein Übungs-Wochenende, wo es ums Atmen ging. Und finde mich in diesem Umfeld wieder, in dem mit lustigen Geräten, so genannten Oximetern, gemessen wird, ob und wie die Sauerstoffsättigung abfällt, wie lange ich meinen Atem anhalten kann und was passiert, wenn sich CO2 im Körper ansammelt.
Ich kann dir subito sagen, was dabei passiert: Es ist sehr sehr unangenehm und du hast das Gefühl, vielleicht sterben zu müssen, wenn du jetzt nicht sofort atmest. Was so nicht stimmt, aber uraltes Überlebensprogramm ist.
Das bringt dich schnell in Kontakt mit tiefen Ängsten, je nachdem auch mit alten Verletzungen der Seele, Traumata.
Die eine Übung etwa konnte ich kaum beginnen: Wir sollten uns nach dem Ausatmen die Nase mit so einem Schwimmnasenclipding verschliessen, dann so lange gehen, bis wir den Drang verspürten zu atmen – und dann laufen, bis es nicht mehr geht. Umgekippt ist niemand, was beweist: Physiologisch ist alles bestens, auch wenn der Sauerstoffgehalt im Blut abnimmt.
Mein Widerstand, das überhaupt zu versuchen, war riesig. Zum einen bestimmt wegen meiner Ängste, logo. Zum andern aber auch, weil sich die gesamte Übungsanlage einmal komplett quer gegen mein eigenes Schaffen ausrichtet.
Liebevolle Zuwendung statt über Grenzen pushen
Wenn ich mit meinen Klient:innen arbeite, dann spreche ich mögliche Widerstände stets an. Lasse die Widerstände sein, wie sie sind und spüre sie ebenso eingebettet in Liebe, wie etwa das Gefühl der Klarheit. Widerstand gegen den Widerstand oder auch Angst vor der Angst führt nicht zu mehr Entspannung, im Gegenteil.
Gerade wenn wir in die Tiefen des Seins eintauchen, ist diese liebevolle Sorgfalt unbedingt notwendig. Es reicht nicht, einfach zu sagen «Respektiert eure Grenzen», wie das im erwähnten Workshop der Fall war.
Wenn diese liebevolle Sorgfalt oder Zuwendung nicht verkörpert ist in jener Person, die da etwas anleitet – dann haben die Worte keinerlei Wirkung.
So zum Beispiel im erwähnten Atem-Workshop: Die unterrichtende Person ist ein extremer Typ, der sich unglaublich pusht und so etwa seinen Atem minutenlang anhalten oder seine Herzfrequenz unglaublich tief fallen lassen kann. Entsprechend verkörpert er diese extreme Energie und seine Worte «sei sanft und push dich nicht über deine Grenzen», bleiben irgendwie leer. Er steht stellvertretend für so vieles, was in der so genannten Wellness-Industrie angeboten wird.
Und das Ganze erinnert mich auch daran, was ich in manchen Kirchen erlebt habe: Die Verkörperung des Gesagten, der Worte, fehlt. Somit fehlt die Glaubwürdigkeit, die Kraft, die Lebendigkeit.
Das wiederum ist eine hilfreiche Einsicht, auch für mein Wirken – Sprich nur über jene Dinge, die du auch verkörperst, die du unmittelbar erlebst. Alles andere ist Spekulation – oder sind, eben, tote Worte.
Der Atem muss nichts
Wenn wir nun wieder zum Atem zurückkommen, was heisst das dann? Ich sehe so viele Menschen, die Mühe haben, tief zu atmen. Volle Atemzüge zu spüren. Da sehe ich es eher als zusätzlichen Stressor, den Atem anzuhalten.
Da möchte ich mit liebevoller Zuwendung arbeiten, dem Atem zeigen, dass er sicher ist, so wie er ist.
Dass er sich entfalten darf, aber nicht muss. Dass tiefe Atemzüge im Bauch eine Option sind, aber nicht etwas, was «wir nun tun sollten».
Dem Atem neugierig nachspüren
Wie das konkret aussieht, ist individuell und hängt davon ab, wo eine Person steht, in ihrer Beziehung zum Atem.
Für mich persönlich heisst das etwa: Ich folge einem Atemzug mit meiner Aufmerksamkeit und werde unglaublich neugierig, möchte jedes Detail spüren und erleben. Bin dabei ganz in einer beobachtenden Position, ganz im Sein.
Die Bewegung des Atems bleibt frei und es fühlt sich an, als würden die Atemzüge mal zu den Schlüsselbeinen, mal ins Knie schwimmen.
Wem das zu komisch klingt, dem empfehle ich diese simple Atemübung aus dem RefLab-Archiv.
Ja, mich interessiert Training im herkömmlichen Sinn kein Bisschen. Mich interessiert vielmehr, wie sich aus dem Sein ein authentisches Spielen mit Dingen wie Atempausen ergeben kann. Da bleibe ich ganz nah bei mir und bin ehrlich, wenn sich etwas nach zu viel, zu intensiv anfühlt. Und begegne dem liebevoll und sanft, lasse es sein, wie es ist.
Das, so zeigt meine Erfahrung, ist zutiefst transformierend. Und in sich ein auf eine ganz andere Art herausforderndes Training.
[1] Jener Ort im Hirn, der alte Überlebensmuster (Flucht – Kampf – Einfrieren) steuert und bei wahrgenommenem Stress das sympathische Nervensystem aktiviert (das heisst zum Beispiel, der Atem und Herzschlag werden schneller, die Sinne sind geschärft).
[2] Da verweise ich gerne auf James Nestors Buch «Breath – Atem», oder auch «Erfolgsfaktor Sauerstoff» von Patrick G. McKeown. Soweit mir bewusst ist, sind die Aussagen beider Autoren jedoch wissenschaftlich umstritten oder zum Teil sogar widerlegt.
Foto von engin akyurt auf Unsplash
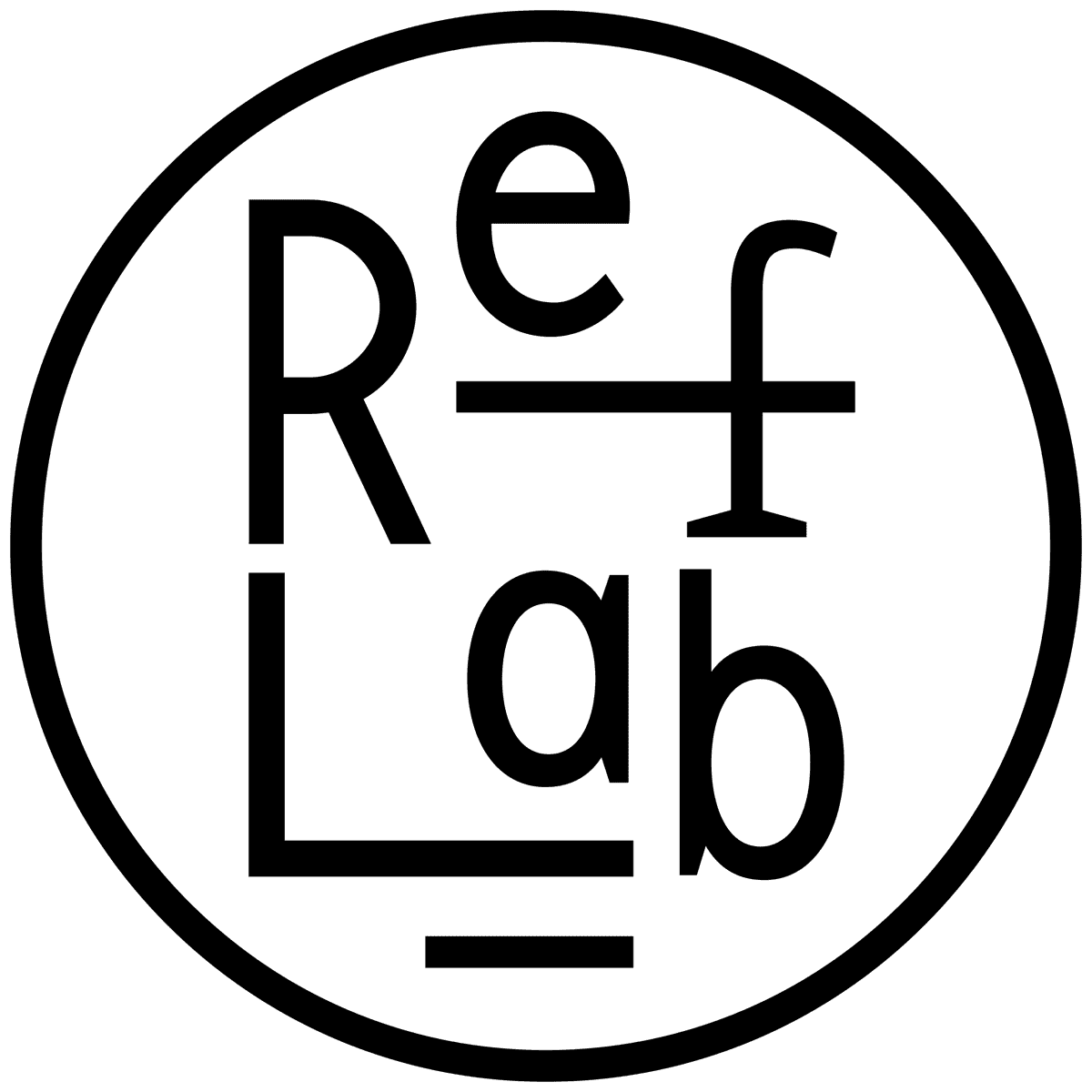

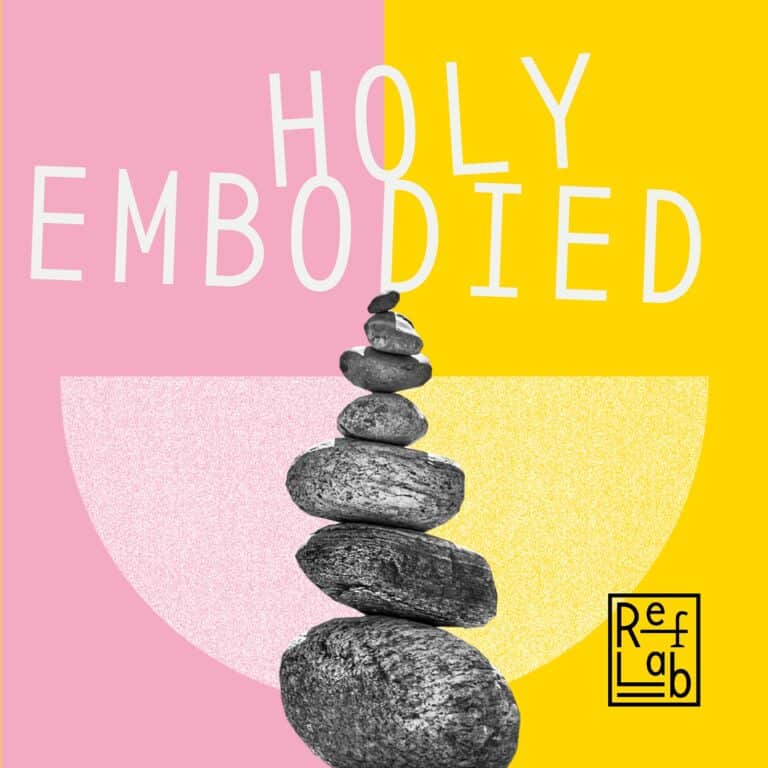





4 Gedanken zu „Atmen – muss das trainiert werden?“
Danke für diesen wunderbaren Beitrag! Ich bin Apothekerin und Yogalehrerin und habe das Buch Breath von Nestor kürzlich gelesen. Es wäre vielen geholfen, wenn sie „einfach“ wieder lernten, ruhig und gleichmässig durch die Nase zu atmen! Om 🙏
Ich freue mich, dass dich dieser Text angesprochen hat liebe Barbara <3
♥️
Merci!
🙏
Danke fürs Lesen liebe Katharina <3