Am vergangenen Mittwoch hatte ich mich zu einem morgendlichen Kaffee mit meiner Kollegin Anne Gidion getroffen. Sie ist die «Bevollmächtige der Evangelischen Kirche bei der Bundesrepublik», sozusagen unsere «Verbindungsoffizierin» zur Politik. Gemeinsam mit ihrem katholischen Kollegen Karl Jüsten hatte sie gerade einen Brief an die CDU verfasst.
Sie hatten deren Pläne, so kurz vor den Wahlen eine Abstimmung über schärfere Regelungen zur Migration durchzuführen, einer vor allem rechtlichen Prüfung unterzogen. Und waren zu dem Ergebnis gelangt, dass die Vorschläge rechtlich kaum haltbar, politisch nicht durchsetzbar und europapolitisch bedenklich seien.
Aktuelle Sicherheitsprobleme würden mit diesem Vorstoss nicht gelöst.
Ressentiments schüren
Das war erst einmal ein normaler Vorgang. Das gehört zur Arbeit der evangelischen und katholischen Büros in Berlin. Aussergewöhnlich war aber die Warnung an die CDU, mit diesem Vorstoss das Risiko einzugehen, der AfD einen parlamentarischen Triumph zu verschaffen und Ressentiments gegen Menschen mit Migrationsgeschichte zu schüren.
Dieser Brief ging an die Medien, und dann lief die Erregungsmaschine heiss. Wir mussten unser Kaffee-Treffen verkürzen.
Was einige Medien daraufhin veranstalteten, gab einen Vorgeschmack auf die folgenden Tage: Aus einem – wie ich finde – in der Sache kritischen, aber gut begründeten, nachdenklichen und im Ton angemessenen Schreiben zweier für die kirchlich-politische Zusammenarbeit Verantwortlichen wurde ein «Brandbrief», in dem «die Kirchen» die CDU «geisselten».
Steigbügelhalter der AfD?
Ein Kommentator bezeichnete «die Kirchen» daraufhin als die «Steigbügelhalter der AfD», weil sie die Sicherheitsbedürfnisse der Bevölkerung missachteten und die Leute den Rechtsextremen in die Arme trieben.
Der Brief der beiden wurde also sofort auf die Freund-Feind-Spule des Wahlkampfs gezogen.
Natürlich kann man diesen Brief auch mit Gründen kritisieren. Der Wiener Theologie Ulrich H. J. Körtner hat dies gerade in den «Zeitzeichen» getan. Körtner vertritt grundsätzlich andere migrationspolitische Vorstellungen. Vor allem aber sieht er in dem Brief einen rechtlich eingekleideten, aber in Wahrheit gesinnungsethischen Versuch, alles beim Alten zu lassen – und damit konservative Christen der evangelischen und katholischen Kirche zu entfremden.
Zudem vermisst er genuin theologische Argumente. Allerdings argumentiert er selbst vor allem politisch und nicht theologisch.
Doch der Brief von Anne Gidion und Karl Jüsten stand nur kurz im Mittelpunkt der Auseinandersetzung. Schnell richtete sich die Aufmerksamkeit auf anderes, vor allem das Schauspiel im Bundestag.
Demonstration der Gesinnung
Sehenden Auges und ohne Not wurde ein Vorschlag der CDU zur Abstimmung gebracht, der nur mithilfe der AfD durchgehen konnte.
Ich habe immer noch nicht verstanden, was den Parteivorsitzenden dazu bewogen und warum er die Sache nicht vom Ende her gedacht hat. Man kann den Vorwurf des Gesinnungsethischen auch dem CDU-Vorsitzenden machen.
Verantwortungsethisch wäre es von ihm gewesen, seine politischen Vorstellungen in eine solche Form zu bringen und so vorher abzustimmen, dass eine demokratische Mehrheit im Bundesrat und danach im Bundesrat möglich gewesen wäre. Dies freilich hätte, so kurz vor der Wahl, wahrscheinlich keine Chance gehabt.
Daher hätter er dieses wichtige Thema als einen Aspekt der gesellschaftlichen Transformation, in der wir uns befinden, der Öffentlichkeit so vorstellen müssen, dass er nach der Wahl mehr Chancen auf Umsetzung gehabt hätte.
Stattdessen wollte Friedrich Merz aber wohl so etwas wie «ein Signal setzen».
Gesinnungsethik im schlechten Sinn
Er brachte Abstimmungen auf den Weg, von denen klar war, dass sie zu nichts führen würden, ausser dass sie seine Gesinnung öffentlich ausstellten. Den Schaden, der dadurch entstand, nahm er in Kauf.
Das kann man Gesinnungspolitik im schlechten Sinne nennen.
Während ich dieses Desaster in zwei Akten verfolgte, fiel mir ein Slogan ein, den mein Lieblingstheologe Ernst Troeltsch während des Ersten Weltkriegs geprägt hatte: «Demobilisierung der Geister». Darin sah er seine Aufgabe im Krieg und dann in der jungen Demokratie: Verständigung zwischen demokratischen Gegnern sowohl aussen- wie innenpolitisch:
- Konzentration auf tragfähige Lösungen
- Kompromissbereitschaft
- und Zusammenarbeit aller nicht-extremen Kräfte
Dazu braucht man selbst einen gut eingestellten ethischen Kompass, aber moralistische Erregung und Verteufelung des politischen Gegners sollte man sich sparen.
Demobilisierung der Geister (Troeltsch)
Im Gegensatz dazu fiel mir auf, wie moralisch aufgeladen die Debatte im Parlament geführt wurde. Die einen beriefen sich pathetisch auf ihr Gewissen, die anderen kritisierten den «Sündenfall» der anderen und sahen das «Tor zur Hölle» geöffnet.
So kritisch ich die Initiative der CDU sehe, so wenig haben mich die Reaktionen der SPD und der Grünen überzeugt – sie haben keinen Grund, sich über andere zu erheben.
Verkehrte Welt: Die politische Rhetorik wurde immer moralischer und religiöser, während die Sprache der Kirchenvertreter in ihrem Brief an den CDU-Kanzlerkandidaten auf Sachlichkeit, Vernunft und Verantwortung eingestellt war. Der Brief aus dem evangelischen und katholischen Büro übte Kritik, aber so, dass ein Gespräch weitergehen kann.
Ach, hätte man in der CDU-Zentrale diesen Brief nur ernst genommen.
Ihrem Vorsitzenden wäre eine bittere Niederlage und unserem Land ein beschämendes, bedrohliches Schauspiel erspart geblieben.
Wie soll es weitergehen?
Vor der Wahl ist nichts Vernünftiges zu erwarten. Für das Danach wünschte ich mir eine «Demobilisierung der Geister»:
- die den legitimen Sicherheitsbedürfnissen der Bevölkerung Rechnung trägt
- die den humanitären Schatz unserer Verfassung bewahrt
- die funktionierende Regeln zur Migration aufstellt und durchsetzt; Regeln, die rechtskonform und mit unseren Nachbarn abgestimmt sind
- die sich den Mühen der Ebene stellt, indem sie zum Beispiel Ausländerbehörden endlich digitalisiert und Sicherheitsbehörden koordiniert
- die – nicht zuletzt – die Integration fördert
- und die bei allem, was sie tut und sagt, einen unmissverständlichen Abstand zu Rechtsextremen und Rassisten hält
Damit Deutschland ein freies, sicheres, weltoffenes, die Rechte aller Menschen achtendes Land – nun ja, ist/bleibt/wird. In diesem Sinne sollten die demokratischen Parteien fair streiten und vernünftig zusammenarbeiten. Ob das nur ein frommer Wunsch ist, wird sich nach der Wahl zeigen.
Foto von Dominik Türk, Pexels
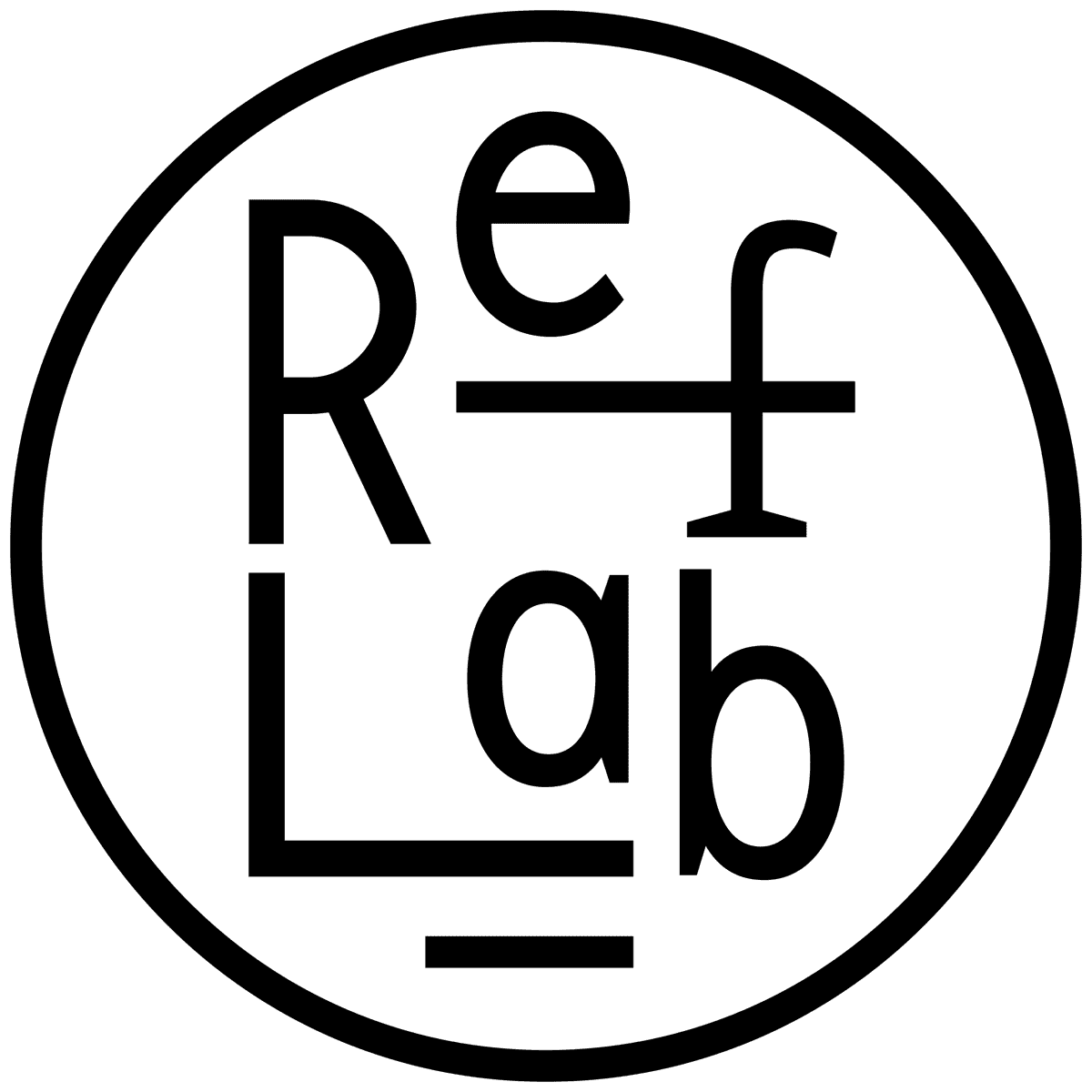
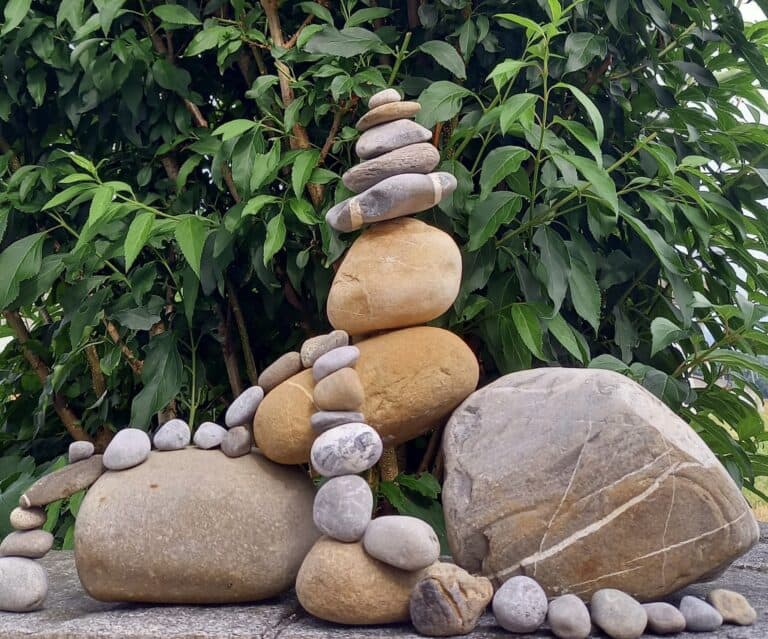






2 Gedanken zu „Angeblicher Brandbrief der Kirchen“
Danke!
“Demobilisierung der Geister” passt sehr gut.
Dilemmata erkennen für sich und andere.
Dilemmata als solche anerkennen und sich der moralisch überheblichen Vereindeutigung, der Rechthaberei enthalten. Das ganz und gar Gute ist kaum je verfügbar.
Solche moralische Bescheidenheit ermöglicht es erst, sich den “Mühen der Ebene” gemeinsam zu unterziehen!
Auf “die Kirchen” trifft das Berpredigt-Wort zu vom “dumm-gewordenem” Salz.
Dabei stellt sich (mir) eindeutig heraus der Unterschied von
a) die Kirche als Kollektiv und
b) das einzelne Mitglied, egal ob Laie oder “Erwerbs”-Christ.