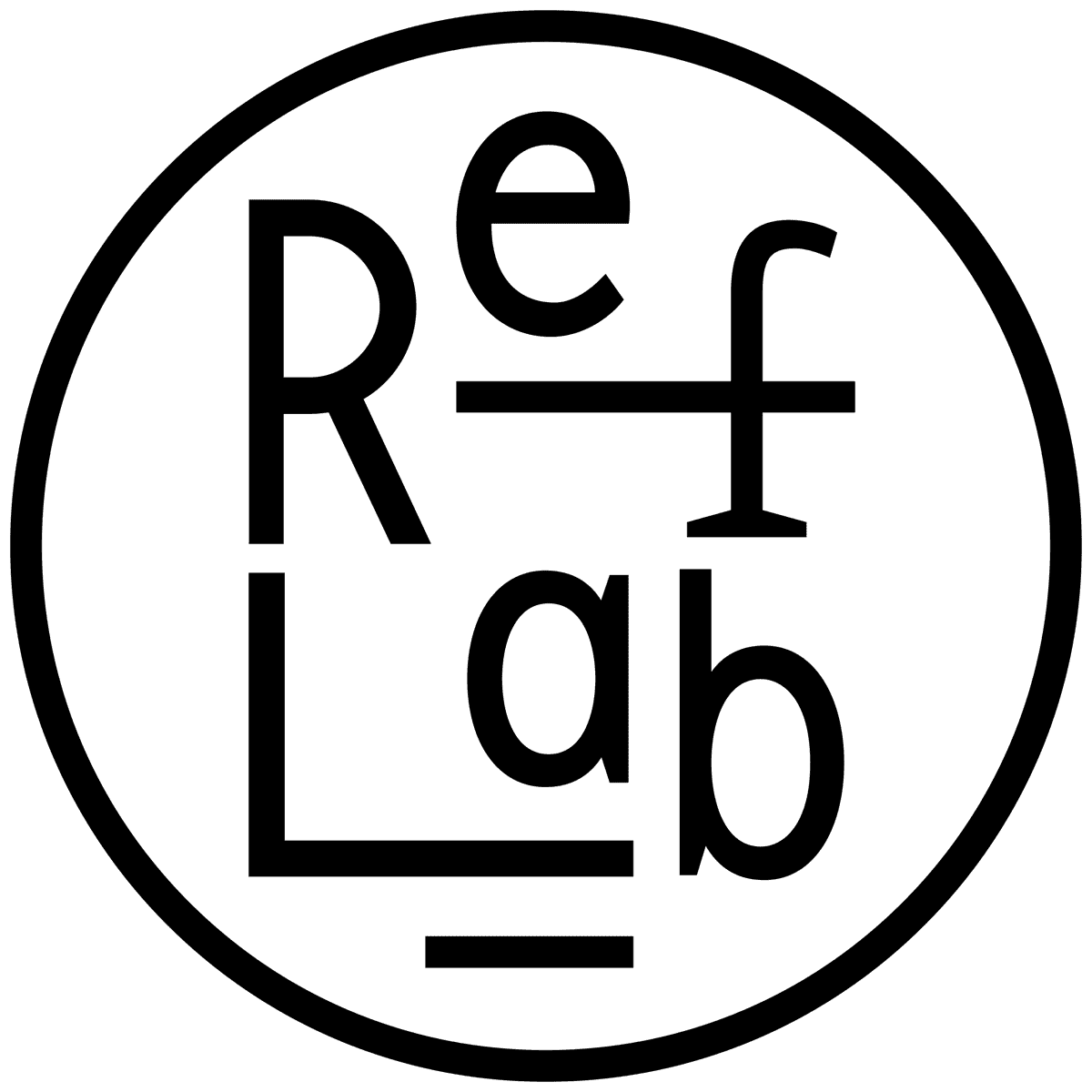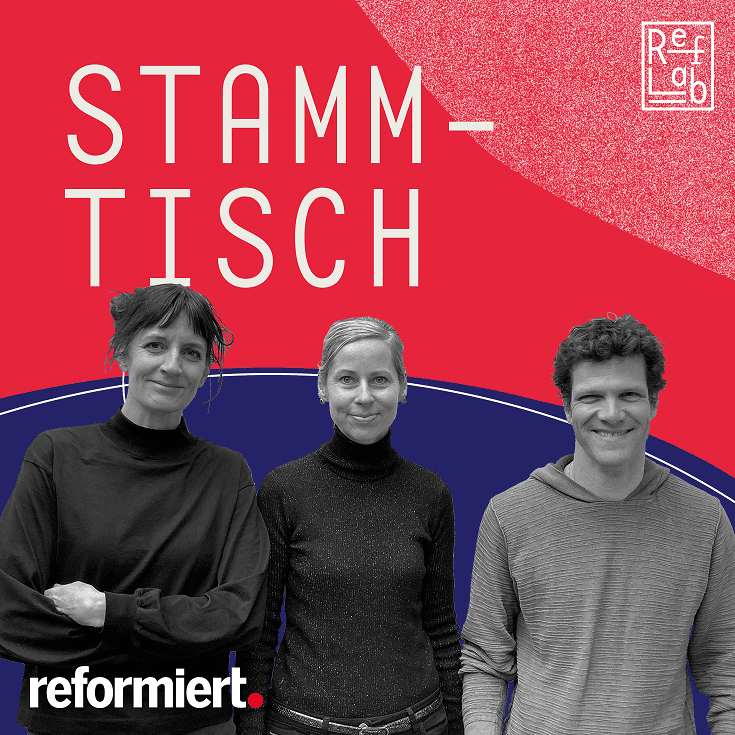Zugegeben, die Vorstellung war anfangs gewöhnungsbedürftig: Nun sollte ich mich also als Teil einer Herde begreifen und im Sinne des Herdenwohls agieren. Es widersprach nicht nur meinen Intuitionen, sondern eigentlich allen Werten und Idealen, die mir als Kind, Jugendliche, Studentin und Bürgerin einer westlichen Demokratienation vermittelt worden waren: nämlich mich als freies, selbständiges und unabhängiges Individuum zu begreifen. Mit anderen Worten: als moderner Mensch.
Aber es leuchtete schon ein, dass in Pandemiezeiten, wo jeder des anderen potenzieller Ansteckungsherd ist, ein Umdenken, eine Neuordnung des Miteinanders und damit auch ein neues Selbstverständnis notwendig waren. In Krisenzeiten möchte man zudem näher zusammenrücken, aber das Gegenteil wurde uns nun abverlangt: die soziale Distanzierung zum Schutz der Herde.
Was heisst es, Teil einer Herde zu sein?
Mit Herde assoziiere ich einerseits die spontane Fähigkeit der Selbstorganisation zum Wohl aller und andererseits hohe Schutzbedürftigkeit. Das hängt mit zwei einschneidenden Erlebnissen zusammen, einem traumhaften und einem traumatischen.
Immer in den Sommermonaten graste in Köln am Rheinufer eine Schafherde. Mit dem Kölner Dom im Hintergrund sah das malerisch aus. Es war wundervoll beim Vorbeifahren mit dem Fahrrad die Laute und Bewegungen der Tiere mitzubekommen. Wenn ich nachts vorbeikam, träumten sie ihre Schafträume und verbreiteten eine fast heilige Stimmung. Aber nicht alle schliefen, sondern zwei oder drei Schafe waren wach und umrundeten die Herde, ganz offensichtlich, um «Wache» zu schieben.
Die Schafherde auf den Rheinterrassen organisierte sich nachts selbst, ohne Hirte oder Hütehund.
Das herdenspezifische Frühwarnsystem half einer anderen Herde leider nicht: Es waren unsere eigenen Tiere, die auf einer Wiese am helllichten Tag von Schäferhunden – ausgerechnet von diesen! – angefallen und zerfleischt wurden. Es war ein regelrechtes Massaker. Im Blutrausch töteten die Hunde viel mehr Tiere als sie fressen konnten. Die wenigen heil davongekommenen Tiere waren traumatisiert. Seither hasse ich Hunde. Für mich zerbrach damals ein Kinderglaube. Ich hatte mich mit den Lämmchen der Herde identifiziert. Auf keinem Kinderfoto sehe ich so glücklich aus wie auf jenem mit Affenschaukelfrisur, Zahnlücken und zwei Lämmchen.
Unsere Bilder vom Paradies sind geprägt von pastoralen Landschaften und Stimmungen, in denen ewiger Friede zwischen den Geschöpfen herrscht. Christliche Gleichnisrede zeugt davon. «Guter Hirte» war eine der frühesten Bezeichnungen für Jesus Christus und in Joh 10,11.14 nennt sich Jesus selbst so. Eine andere Bezeichnung lautet «großer Hirte der Schafe» (Heb 13.20). Der gute Hirte überlässt 99 Schafe sich selbst, um nach dem einen «verlorenen Schaf» zu suchen. Dies lässt sich als Hinweis lesen, dass in der Bibel die Herde nicht über dem Individuum steht. Der Vergleich der Gläubigen mit Schafen, die eine Herde bilden, leuchtete Menschen jahrhundertelang ein. Jesus passt gut auf seine Schafe auf. Priester sind Pastoren.
Heute passt das Bild von Jesus als Hirten nicht mehr zur Lebenswelt der allermeisten. Auch missfällt die Idee eines Oberhirten, ganz zu schweigen vom Ende der Schafe auf der Schlachtbank.
Entschärfung des Herdenzwangs
Abgesehen davon, dass wir uns nicht gern mit Tieren vergleichen, mag der dem Herdenmotiv innewohnende paternalistische Zug – bei der Herde denken wir den Hirten mit – mit dazu beigetragen haben, dass der Begriff aus der Veterinärepidemiologie befremdlich blieb. Mit dem Abschied der Aussicht auf Herdenschutz können wir nun wieder zu humanmedizinischer Terminologie zurückkehren. Gleichtzeitig stirbt eine Hoffnung. Wir müssen uns von der schönen und tröstlichen Vorstellung verabschieden, dass altruistisches Verhalten ein sukzessives Absterben des Erregers COVID-19 mitbefördert, der der Menschenherde seit seinem Auftauchen Ende 2019 den Atem raubt.
Ohne Aussicht auf Herdenschutz sind wir mit der Entscheidung, uns impfen zu lassen oder nicht, auf uns zurückgeworfen. Wenn Herdenschutz tatsächlich nicht erreichbar sein sollte und Geimpfte wie Nichtgeimpfte Viren übertragen, betrifft die Impfentscheidung vor allem die eigene Gesundheit.
Wer sich impfen lässt, schützt sich selbst. Geimpfte tragen aber gleichzeitig dazu bei, dass Intensivstationen nicht überlastet werden, da schwere Krankheitsversläufe nicht zu erwarten sind. Da aber geimpfte Infiziere häufiger symptomfreie Verläufe haben, vergrössert sich die Gefahr der unwissentlichen Verbreitung des Erregers.
Auf den Hirten im Pandemiepark lasten übergrosse Erwartungen. Epidemiolog:innen aber sind keine allwissenden Götter. Das sich wild gebärdende und unberechenbar mutierende Virus überrascht uns und führt in immer neuen Volten die Kontingenz das Daseins vor Augen. Was uns bleibt, ist (gegen den Augenschein) an das Pandemieende zu glauben, und woran wir uns halten können, ist der dunkle Hölderlin-Spruch:
«Wo aber Gefahr ist, wächst / Das Rettende auch.»
Mit Blick auf Herdenschutz in der vierten Coronawelle und angesichts der gefährlichen Delta-Mutation ist zuletzt «Durchimpfung» zum ethischen Gebot avanciert. «Impfobligatorium» bzw. «Impfzwang» sind zunehmend aggressiv gefordert worden. Impfunwillige wurden in der moralisch gefärbten Debatte als schwarze Schafe an den Pranger gestellt. Als Konsequenz der neuen Lagebeschreibung durch Epidemiolog:innen dürfte sich jetzt immerhin die Polarisierung zwischen dem Impflager und den Impfungläubigen etwas entschärfen.
Photo by Siegfried Poepperl on Unsplash