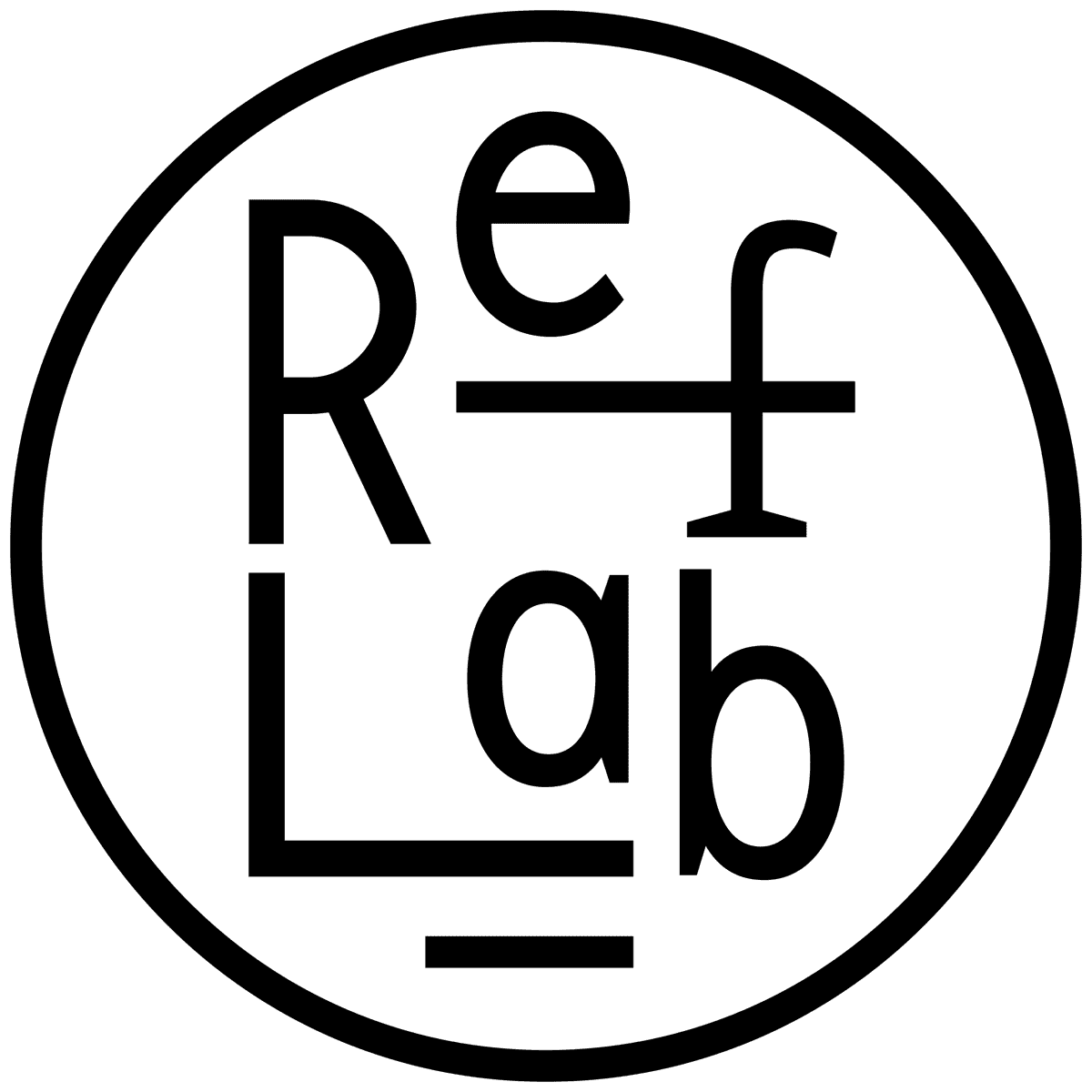Vorbemerkung: Der folgende Text von Heinzpeter Hempelmann ist die überarbeitete und gekürzte Fassung eines Aufsatzes, der in Heft 1/2025 der Zeitschrift «Theologische Beiträge» erscheinen wird. Das «mindmaps»-Podcastgespräch geht den wichtigsten Punkten dieses Textes nach.
1. Kant als Aufklärer, der sich zum Vormund macht
«Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbst verschuldeten Unmündigkeit.Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Selbstverschuldet ist diese Unmündigkeit, wenn die Ursache derselben nicht am Mangel des Verstandes, sondern der Entschließung und des Mutes liegt, sich seiner ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Sapere aude! Habe Mut dich deines eigenen Verstandes zu bedienen! ist also der Wahlspruch der Aufklärung.
Faulheit und Feigheit sind die Ursachen, warum ein so großer Teil der Menschen, nachdem sie die Natur längst von fremder Leitung frei gesprochen (naturaliter maiorennes), dennoch gerne zeitlebens unmündig bleiben; und warum es Anderen so leicht wird, sich zu deren Vormündern aufzuwerfen. Es ist so bequem, unmündig zu sein. Habe ich ein Buch, das für mich Verstand hat, einen Seelsorger, der für mich Gewissen hat, einen Arzt, der für mich die Diät beurteilt, u.s.w., so brauche ich mich ja nicht selbst zu bemühen. Ich habe nicht nötig zu denken, wenn ich nur bezahlen kann; andere werden das verdrießliche Geschäft schon für mich übernehmen. Daß der bei weitem größte Teil der Menschen (darunter das ganze schöne Geschlecht) den Schritt zur Mündigkeit, außer dem daß er beschwerlich ist, auch für sehr gefährlich halte: dafür sorgen schon jene Vormünder, die die Oberaufsicht über sie gütigst auf sich genommen haben.» (Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung? [AA VIII,33-42])
Kants berühmte Beantwortung der Preisfrage der Berliner Akademie der Wissenschaften ist seither unzählige Male zitiert, dokumentiert und ins Feld geführt worden. Sie ist freilich ein sehr frühes Beispiel für das, was im 20. Jh. Theodor W. Adorno und Max Horkheimer als «Dialektik der Aufklärung» (1944) aufdecken.
Auch die Aufklärungsschrift offenbart die Position, in der Kant sich sieht. Bezeichnend ist ihr Ton. Er spricht «von oben herab», er redet imperativisch, in Aufforderungen, wie Eltern mit ihren noch nicht reifen Kindern. Er klagt an, der «Faulheit und Feigheit».
Kant verwickelt sich schon durch die Anklagen in Widersprüche. Wenn jemand nicht mündig ist, sich selbst nicht helfen kann, aus welchen Gründen auch immer, hilft es ihm nicht, ihn aufzufordern, sich doch endlich selbst zu helfen.
Er macht Vorwürfe, wie man sie einem störrischen Kind macht: Du könntest doch, wenn du nur wolltest. Du willst ja gar nicht erwachsen werden.
Wer spricht hier, aus welcher – angemaßten – Position? Auf diesen Punkt hat Hamann in einer raschen brieflichen Reaktion an einen anderen Freund, Christian Jakob Kraus, den Finger gelegt:
«[…] Ich frage […]: Wer ist der andere, von dem der kosmopolitische Chiliast weißsagt. (…) Antwort: der leidige Vormund, der als das correlatum der Unmündigen implizite verstanden werden muss. Dies ist der Mann des Todes. Die selbstverschuldete Vormundschaft und nicht die Unmündigkeit –
Wozu verfährt der Chiliast mit diesem Knaben Absalom so säuberlich? Weil er sich selbst zu der Claße der Vormünder zählt, und sich gegen unmündige Leser dadurch ein Ansehn geben will – Die Unmündigkeit ist also nicht weiter selbst verschuldet, als in so fern sie sich der Leitung eines blinden oder unsichtbaren […] Vormundes und Führers überläst. […]
Worinn besteht nun das Unvermögen oder die Schuld des fälschlich angeklagten unmündigen? In seiner eigenen Faulheit und Feigheit? Nein, in der Blindheit seines Vormundes, der sich für sehend ausgiebt, und eben deshalb alle Schuld verantworten muss.
Mit was für Gewißen kann ein Raisonneur u Speculant hinter dem Ofen und in der Schlafmütze den Unmündigen ihre Feigheit vorwerfen, wenn ihr blinder Vormund ein wohldisciplinirtes zahlreiches Heer zum Bürgen seiner Infallibilität und Orthodoxie hat. Wie kann man über die Faulheit solcher unmündigen spotten, wenn ihr aufgeklärter und selbstdenkender Vormund, wofür ihn der […] Maulaffedes ganzen Schauspiels erklärt, sie nicht einmal für Maschinen, sondern für bloße Schatten seiner Riesengröße ansieht, vor denen er sich gar nicht fürchten darf, weil sie seine dienstbaren Geister […] sind […].» (Hamann: Brief an Christian Jacob Kraus vom 18. Dezember 1784, in: ders.: Briefwechsel. Bd. 5, 1783-1785, hg. von Walther Ziesemer und Arthur Henkel, Frankfurt a.M. 1965, 290,7-32. – Die folgenden Angaben im Text beziehen sich auf diesen Brief.)
Hamann deckt auf:
(1) Die Frage ist doch, wer hier redet. «Wer ist aber der unbestimmte andere, der zweymal anonymisch vorkommt»? (289,35) Hamann identifiziert genau in diesem unbestimmt bleibenden Anderen den blinden Fleck und die Achillesverse der Aufklärungsschrift. Wer ist dieser «Andere»? An Kraus schreibt er: «Sehen Sie hier, […] wie ungern die Metaphysiker ihre Personen bey ihrem rechten Namen nennen» (289,36 – 290, 1)?
Schon die Abstraktion ist es, die die Anonymität ermöglicht; sie ist der «proton pseudos» (298,29). Die Verhältnisse sind konkret und bestimmt und müssen, will man sie ändern, auch so angegangen werden.
Hätte Kant tacheles gesprochen, hätte er zum einen sich selber als Vormund zu erkennen geben müssen.
Wer ist der «Leiter, den der Verf. im Sinne aber nicht auszusprechen das Herz hat»? Es ist der «leidige Vormund» doch «das correlatum der Unmündigen», der hier «implicite» mitgegeben ist.
Ohne Vormund doch keine Unmündigen! Keine Anklage von Unmündigen ohne den, der sich hier gerade die Rolle des Vormunds anmaßt.
Dieser Vormund aber ist nicht nur «blind» – für die eigene Vormundschaft -, sondern auch «unsichtbar», er versteckt sich hinter dem Anonym. Wie kann man dann, unter diesen Umständen, noch von der Schuld der in Unmündigkeit Gefallenen und Gehaltenen reden?
(2) Hamann denkt aber auch politisch. Er denkt an den zweiten «Anderen», spricht kaum verhohlen von dem, den Kant nicht zu nennen wagt. Er deckt den Vormund dessen auf, der sich zum Vormund macht. Wie verhält sich Kant zu seinem eigenen Vormund? Dieser Andere hat «ein wohldisciplinirtes zahlreiches Heer zum Bürgen seiner Infallibilität und Orthodoxie» (290,26f).
Kant versteckt sich hinter dem Preußenkönig, dessen Autorität nur unter Gefahr angetastet werden kann. Hamann kritisiert, dass Kant als «Raisonneur und Speculant hinter dem Ofen und in der Schlafmütze» (290,24f), also aus dem sicheren akademischen Elfenbeinturm, «den Unmündigen ihre Feigheit» (290,25) vorwirft.
Wer ist hier feige? Wer geht hier selbst in Deckung und fordert andere auf, mutig zu sein?
Die andere große Frage lautet: Welche Position wird den Adressaten in diesem Sprachspiel zugewiesen; welche wird für sie vorausgesetzt? Werden sie nicht durch diese Ansprache genau an der Stelle festgehalten, die Kant ihnen so eloquent vorhält?
Kant wirft seinem Publikum vor, dass es sich seines Verstandes nicht «ohne Leitung eines anderen» bedient; er leitet es aber just in diesem Moment selber an. Er mutet ihm zu, sich endlich selbst des «eigenen Verstandes zu bedienen», entmündigt es aber im selben Atemzug, indem er es unter die Vorgaben des eigenen Verstandes stellt.
Es soll endlich aktiv werden, wird aber genau durch die Aufforderung zum Gehorsam, zum Selberdenken, in eine passive Rolle gedrängt. Es soll selber denken, wird aber aufgefordert, seinem: Kants, Verstand zu folgen. Er wirft seinem Publikum, «darunter das ganze schöne Geschlecht» (AA VIII, 35, 18f), vor, nicht den Schritt zur Mündigkeit zu gehen, macht sich aber just damit selber zum – neuen – Vormund.
Er fordert sie auf, selber zu denken, schreibt ihnen just damit vor, wie sie zu denken haben. Er moniert, dass es anderen «so leicht [gemacht; hph] wird, sich zu […] Vormündern aufzuwerfen», und merkt nicht, dass er selbst es dem unaufgeklärten Volk so leicht macht, sich bevormunden zu lassen; man muss ja nur ihm, seinen Anweisungen folgen.
Er wirft vor, dass Menschen «zeitlebens unmündig» bleiben, und trägt selber durch die Qualifikation seines Publikums als unmündig und aufklärungsbedürftig und durch die Zumutung, ihm dem Aufklärer, zu folgen, genau zur Perpetuierung der Abhängigkeit vom Denken eines anderen bei.
Kant amüsiert sich über die «Vormünder, die die Oberaufsicht […] gütigst auf sich genommen haben» und reflektiert nicht die Rolle, die er als Oberaufseher über das unmündige Publikum gütig auf sich genommen hat, dem man auf die Sprünge helfen muss.
Aber was kümmert es einen Aufklärer, sich in metatheoretische Widersprüche zu verwickeln, wenn nur die eigene – gute – Absicht stimmt. Wenn sie und weil sie – selbstverständlich – gut und richtig ist, darf sie auch bevormunden.
Auf diese Logik der Aufklärung, auf diesen Habitus der Aufklärung, für den Kant Vorbild ist, stoßen wir bis heute: immer dann, wenn Menschen – im Namen der Aufklärung, also eines gewiss überlegenen Anliegens – anderen Menschen erklären wollen, wie sie zu denken, reden und handeln haben, wenn anders sie gut, richtig, moralisch sein wollen. Wenn sie dabei Macht ausüben, tun sie es im Dienst der guten Sache.
Wie schon Kant sich zur Kritik aller und alles anderen berechtigt sah, für Möglichkeit der Kritik an seiner Position aber keine Notwendigkeit und darum keinen Raum vorsah, so reicht es auch heute, im Namen einer guten Sache, die man jedenfalls selbst für gut hält und entsprechend absolut setzt, aufzutreten.
Zu den verhängnisvollen Konsequenzen solch eines philosophischen Habitus kommen wir.
Auch bei diesem Programmaufsatz Kants und der ganzen Aufklärung ist zu spüren, dass für Kant die zentrale Frage ist: «Was ist der Mensch?» Die Antwort, die Kant hier gibt und die sich auch an anderen Stellen massiv auswirkt, ist: ein vor allem rationales Wesen, das zur Selbstbestimmung und das meint eben auch zum Umdenken, zur Umkehr, zu verändertem Handeln nach entsprechender Einsicht in der Lage ist.
Man darf schon an dieser Stelle fragen, wie realistisch dies aus der Sicht der Erfahrung der beiden letzten Jahrhunderte ist.
Es könnte sehr gefährlich sein, allein oder vor allem auf Vernunft zu setzen, wenn dieses Menschenbild einseitig oder gar illusionär ist. Wenn Kant, wenn wir hier irren, gefährden wir gerade die Grundlagen unserer liberalen Demokratie.
2. Kant als Humanist? Zerstört sein Autonomie-Konzept die Menschenwürde?
«Was sich auf die allgemeinen menschlichen Neigungen und Bedürfnisse bezieht, hat einen Marktpreis; […] das aber, was die Bedingung ausmacht, unter der allein etwas Zweck an sich selbst sein kann, hat nicht bloß einen relativen Wert, d.i. einen Preis, sondern einen inneren Wert, d.i. eine Würde.
Nun ist Moralität die Bedingung, unter der allein ein vernünftiges Wesen Zweck an sich selbst sein kann, weil nur durch sie es möglich ist, ein gesetzgebend Glied im Reiche der Zwecke zu sein. Also ist Sittlichkeit und die Menschheit, sofern sie derselben fähig ist, dasjenige, was allein Würde hat. […]
Und was ist es denn nun, was die sittlich gute Gesinnung oder die Tugend berechtigt, so hohe Ansprüche zu machen? Es ist nichts geringeres als der Anteil, den sie dem vernünftigen Wesen an der allgemeinen Gesetzgebung verschafft und es hiedurch zum Gliede in einem möglichen Reiche der Zwecke tauglich macht, wozu es durch seine eigene Natur schon bestimmt war, als Zweck an sich selbst und eben darum als gesetzgebend im Reich der Zwecke, in Ansehung aller Naturgesetze als frei, nur denjenigen allein gehorchend, die es selbst giebt und nach welchen seine Maximen zu einer allgemeinen Gesetzgebung (der es sich zugleich selbst unterwirft) gehören können. Denn es hat nichts einen Werth als den, welchen ihm das Gesetz bestimmt. Die Gesetzgebung selbst aber, die allen Werth bestimmt, muß eben darum eine Würde, d.i. unbedingten, unvergleichbaren Werth, haben, für welchen das Wort Achtung allein den geziemenden Ausdruck der Schätzung abgiebt, die ein vernünftiges Wesen über sie anzustellen hat. Autonomie ist also der Grund der Würde der menschlichen und jeder vernünftigen Natur.» (Immanuel Kant: Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, in: AA IV, 434, 31 – 436,7. Die folgenden Angaben im Text beziehen sich auf diese Schrift)
«Würde» hat nach Kant nur das, was «einen Zweck an sich selbst» hat.
Zweck an sich selbst kann es aber nur unter der «Bedingung» der «Moralität» geben – Moralität ist hier nicht zu verstehen im Sinne einer moralischen Qualität, also eines Gut-Seins, sondern als Fähigkeit zu sittlichem Handeln. Über diese Fähigkeit verfügen nur «vernünftige Wesen»: solche, die ein «gesetzgebend Glied im Reich der Zwecke» sein können, d.h. sich selbst und andere bestimmen können.
«Moralität» bedeutet, nur den Gesetzen «allein gehorchend» zu folgen, «die es giebt». Voraussetzung dafür ist die rationale Fähigkeit zu autonomer Selbstbestimmung.
Ein Individuum, das Würde haben können soll, muss fähig sein zu «Maximen zu einer allgemeinen Gesetzgebung (der es sich zugleich unterwirft)».
Gemeint ist der kategorische Imperativ: «Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, daß sie ein allgemeines Gesetz werde» (Ebd., 421, 7f.). Würde und damit Wert verschafft nur die Teilnahme an dieser Gesetzgebung, die das Verhältnis der Menschen untereinander vernünftig regelt und die darum zur Voraussetzung vernünftige und wollende Wesen hat.
«Nur ein vernünftiges Wesen hat das Vermögen, nach der Vorstellung der Gesetze, d.i. nach Principien, zu handeln, oder einen Willen. Da zur Ableitung der Handlungen von Gesetzen Vernunft erfordert wird, so ist der Wille nichts anderes als praktische Vernunft.» (Ebd., 412,26-28)
Diese Fähigkeit zur Autonomie, die einen intentional ausgerichteten, nicht unbedingt zur Erfüllung seiner Ziele kommenden (vgl. ebd., 394,13ff.), auch nicht unbedingt Gutes anstrebenden Willen voraussetzt, ist die fundamentale Bedingung dafür, dass einem Wesen Menschenwürde zukommt.
Ein Wesen mit Würde muss fähig sein, sich zur allgemeinen Gesetzgebung (d.h. dem kategorischen Imperativ) bestimmen zu wollen, weil «die Vorstellung des Gesetzes an sich selbst [….] nur im vernünftigen Wesen stattfindet» (401,11f).
Kants intellektualistisches, auf Vernunft, Autonomie, Freiheit und Willen abhebendes Menschenbild führt dazu, dass nur Menschen, die zu Freiheit und Autonomie fähig sind, als Personen Menschenwürde zukommt.
Nur vernünftige, zum Vernunftgebrauch fähige Wesen, haben Anspruch auf die Achtung, die Menschenwürde begründet. Sie sind «Personen». Menschen dagegen, im Sinne von homo sapiens sapiens, sind nicht per se solche Personen (vgl. 389,27ff). Die Gesamtheit der Menschen deckt sich nicht mit der Gesamtheit der vernünftigen Wesen.
Kants intellektualistische Ethik baut auf Sittlichkeit, Freiheit, und als deren Voraussetzung auf Autonomie: die Fähigkeit zur Selbstbestimmung, auf.
Diese Ethik verlangt die Befähigung zum Vernunftgebrauch als Voraussetzung der Achtung durch andere.
Ist diese nicht gegeben, ist ein Mensch womöglich biologisch Mensch, aber eben nicht Person.
Die Befolgung des die Ethik im Kern bedeutenden kategorischen Imperativs setzt genau dieses Einsichtsvermögen voraus. Es ergibt sich der bemerkenswerte Sachverhalt, dass Kant eine Ethik vorlegt, die nicht nur für Menschen, sondern für vernünftige Wesen allgemein, etwa auch auf anderen Planeten, gilt; daß umgekehrt Menschenwürde nicht allen Menschen zukommt, sondern nur denen, die Vernunft haben, also Personen sind.
Euthanasie wird philosophisch geradezu angebahnt, wenn Kant auf der Basis dieses Menschenbildes feststellt: «Die Wesen, deren Dasein nicht auf unserm Willen, sondern der Natur beruht, haben […] wenn sie vernunftlose Wesen sind, nur einen relativen Werth, als Mittel, und heißen daher Sachen, dagegen vernünftige Wesen Personen genannt werden, weil ihre Natur sie schon als Zwecke an sich selbst […] auszeichnet» (428, 18-24).
Resultat dieser allein auf das Vernunftvermögen des Menschen setzenden intellektualistischen Anlage des Menschenbildes ist eine Anthropologie, die den Menschen nicht extern, als Gottes Ebenbild, auch nicht biologisch, als Gattungswesen bestimmt, sondern allein von seiner kognitiven Kapazität her.
Er muss begreifen können, was der kategorische Imperativ als vernünftige Richtschnur des Handelns bedeutet. Die traditionelle Begründung von der Gottesebenbildlichkeit her ist nicht akzeptabel, weil sie «Gott» material und nicht transzendental versteht; die zweite Definition ist für Kant nicht akzeptabel, weil sie ihn nur empirisch auszeichnet, ihn zum Tier macht, das als solches nur und solange eine «Sache» ist, wie es nicht vernunftbegabt ist und als solches Wesen dann nicht nur Mittel, sondern auch Zweck an sich selbst ist und als solches dann auch die menschliche Achtung verdient.
Die Vernunftfähigkeit im Sinne kognitiver und mentaler Kompetenz zur Selbstbestimmung entscheidet darüber, ob einem Menschen Menschenwürde zukommt, in der Terminologie Kants: ob ein Mensch eine Person ist. Andernfalls mag er – biologisch – Mensch sein, ist aber ethisch nur «Sache», weil er weder sich selbst noch andere als Zwecke in sich selbst begreifen kann.
Der Wert eines Menschen ist also nicht an sich gegeben; seine Würde ist nicht unbedingt und unverlierbar. Menschenwürde beruht – allein – auf der gegenseitigen Anerkennung von anderen als vernünftigen Wesen, die – wegen ihrer Fähigkeit zum Vernunftgebrauch und zur Selbstbestimmung – Achtung verdienen, übrigens unabhängig davon, in welcher Weise sie ihre Autonomie nutzen.
Man darf in dieser rationalistischen Konzeption des Menschen und ihren verheerenden Konsequenzen ein Beispiel für das finden, was Robert Sapolsky aus verhaltensbiologischer Sicht beschreibt: «Wenn Menschen von ihrer Vernunft überzeugt sind, sind sie besonders anfällig für Rationalisierungen, die sie von moralischer Verantwortung entlasten. Das führt zu gefährlichen Rechtfertigungen für unmoralisches Verhalten.» (Was lehren uns Paviane über Politik?, in: ZEIT Nr. 46/2024 29. Oktober 2024)
Wir haben hier eines der schrecklichen Beispiele von Ethik-Begründung vor uns, die mit Emmanuel Levinas fragen lassen, ob wir so fundamental wichtige Anliegen wie die Sicherung der Würde des Menschen, jedes Menschen, auch des behinderten Menschen auf abstrakten Distinktionen – wie z.B.: Mensch und Person, vernünftige und der Vernunft nicht fähige Menschen, Menschen und Sklaven, Menschen und Unter-Menschen – gründen wollen.
3. Kants rationalistische Ethik-Begründung (1): Frieden durch Vernunft?
Kurz nach dem Separatfrieden von Basel zwischen Preußen und Frankreich veröffentlicht Kant seine kleine Schrift «Zum ewigen Frieden» (AA VIII; die folgenden Angaben im Text beziehen sich auf diese Schrift), die er in den Jahren zuvor, angesichts der andauernden Kriegswirren, geschrieben hatte, aber nicht veröffentlichen wollte.
Von einem kriegsmüden und sich nach dauerhaftem Frieden sehnenden Deutschland und Europa wird dieser Programmentwurf eines rational durchdachten und bis in Paragraphen ausformulierten Friedensvertrags, der den Weg in einen in der Zukunft erreichbaren Zustand dauerhaften, «ewigen» Friedens weisen soll, begeistert aufgenommen. In kurzer Zeit werden mehrere Auflagen und Übersetzungen nötig.
Die Schrift hat bis in die Gegenwart Einfluß, und einige ihrer Ideen sind sowohl in die Gründungsurkunde des Völkerbundes wie dann später der UNO eingegangen.
Das macht die vom «späten Kant» gewagte Übertragung seiner Moralphilosophie in den Bereich des Politischen, ja ins Völkerrecht so wichtig und – entgegen einem weitgehenden, lange bestehenden Konsens im Bereich politischen Denkens – auch so problematisch.
Ausgangspunkt ist auch für diese politische Schrift die Ansprechbarkeit des Menschen auf seine Vernünftigkeit: seine Fähigkeit, durch Reflexion sein Handeln zu steuern, auch wenn es um das Verhältnis von Kollektiven von Menschen, also das Völkerrecht geht.
Natürlich trägt die explizit die Züge einer Utopie, aber es handelt sich nach Kant doch um eine konkrete, eine realistische und realisierbare Utopie.
Im Gegensatz zu anderen Klassikern des politischen Denkens orientiert sich Kant nicht an historischen Friedensprozessen und -verträgen. Seine Überlegungen resultieren nicht aus der Reflexion von Geschichte. Kant argumentiert nicht weisheitlich, indem er zusammen trägt, was sich bewährt hat, um Frieden zu erreichen. Er definiert Frieden rein rational und versucht den Begriff des ewigen Friedens, also der dauerhaften Abwesenheit von Krieg und Konflikten im Verhältnis der Völker völlig a priori, also unabhängig von der Erfahrung zu bestimmen.
Dementsprechend gestaltet sich nach Kant auch der Weg dorthin.
Kants Mittel, den ersehnten Zustand zu erreichen, ist ein quasi komplett ausformulierter Friedensvertrag mit sechs sog. Präliminarartikeln, die konkrete Handlungsziele, Bedingungen für ewigen Frieden festlegen, und drei Definitiv-Artikeln, die verhindern sollen, dass es fortdauernd zu Kriegshandlungen kommt.
So darf man – Präliminarartikel 1 – nicht im Geheimen einen neuen Krieg planen und den Frieden also nur scheinbar wollen, ihn in Wahrheit zur Vorbereitung eines neuen Krieges nutzen. Man darf – Präliminarartikel 2 – Staaten nicht als «Sachen» behandeln, verdinglichen und «tauschen», schenken, erwerben: «Ein Staat ist nämlich nicht […] eine Habe» (344,17f). Staaten dürfen sich nicht – so Präliminarartikel 5 – in die Angelegenheiten anderer Staaten einmischen. Es dürfen – so Präliminarartikel 6 – keine ehrlosen Kriegsmethoden angewandt werden, und – besonders bezeichnend Präliminarartikel 4 – ein Staat darf keine Schulden aufnehmen, um sein Heer zu finanzieren. Dann überfällt er womöglich noch ein anderes Land, weil er kein Geld mehr hat, um sich zu sanieren. Das muss vermieden werden. Aus dem Grund soll dann auch – Präliminarartikel 3 – ein stehendes Heer verboten sein.
Das sind anerkanntermaßen vernünftige Vorschläge.
Es ginge allen besser, wenn sich alle an diese Vorgaben halten würden. Nur, warum halten sich dann Staaten so wenig an diese Ordnungen, trotz UN-Völkerrechtskonvention,- v.a. dann, wenn sie einen Vorteil darin sehen, bei gegebener Konvention und vertraglicher Ordnung genau gegen diese Konvention zu handeln, die Ordnungen zu brechen, etwa Giftgas einzusetzen, wenn ihnen das auf Grund der Machtverhältnisse möglich ist? Antwort:
Weil es nicht vernünftig ist, allein auf die Vernunft, allein auf die Vernünftigkeit des Menschen als einem rein rational kalkulierenden Wesens zu setzen.
Kant hält die rechtliche Konzeptionierung des weltbürgerlichen Zustandes für möglich und setzt – auch hier – auf die verpflichtende Kraft abstrakt überzeugender Normen. Was rational ist, muss doch alle überzeugen und in ihrem Handeln leiten!
Ausgerechnet der «Kantianer» Jürgen Habermas weist auf die «Widersprüchlichkeit dieser Konstruktion» hin:
Einerseits kann Kant unter einem einen solchen Friedensvertrag vorbereitenden Kongreß «nur eine willkürliche, zu aller Zeit ablösbare Zusammentretung verschiedener Staaten» verstehen; andererseits benötigt eine solche Konstruktion «die Permanenz der Verbindung», die ja Basis der zivilen Lösung internationaler Konflikte sein muss.
Auch heutzutage kann man beobachten, wie Staaten «bei Bedarf» aus internationalen Verträgen austreten bzw. ihre Mitgliedschaft ruhen lassen.
Ein Friede gewährleistendes Institut lebt davon, dass sich die teilnehmenden Partner/ Völker anders als bei vorübergehenden Allianzen «verpflichtet fühlen, gegebenenfalls die eigene Staatsräson dem erklärten gemeinsamen Ziel unterzuordnen».
Worin aber soll eine solche Verpflichtung begründet sein, v.a. wenn dem eigene Interessen entgegenstehen?
Da der Völkerbund ja keine Institution mit staatlicher Qualität und zwingender Autorität sein kann, kann diese Verpflichtung nur moralischer Natur sein. Worin aber soll deren zwingende Kraft liegen?
So kann und muss man etwa nach dem (Zer-)Bruch der europäischen, nach Kantischen Maximen gestalteten Nachkriegsordnung durch den Überfall auf ein europäisches Land und der nachfolgenden Fassungs- und Sprachlosigkeit fragen, die das zivilisierte Europa erfasst hat, das erstarrt, verführt durch ein rationalistisch-intellektualistisches Konstrukt, mit dem man meinte, auf Dauer Mächte zähmen zu können.
Habermas sieht – schon vor dem Ukraine-Konflikt – klar, dass Kant das Problem der Normativität «mit einem bloßen Appell an die Vernunft» «verschleiert» hat. Kant beantworte die entscheidende Frage, «worauf ich dann das Vertrauen zu meinem Rechte gründen wolle», mit dem Hinweis, es sei «der freie Föderalism […], den die Vernunft [!] mit dem Begriff des Völkerrechts notwendig [!] verbinden muß» (AA VIII, 356,32-34).
Habermas fragt zu Recht zurück, «wie denn die Permanenz der Selbstbindung von Staaten, die als Souveräne fortbestehen, gesichert werden kann». Weniger verklausuliert formuliert:
Wer ist diese «Vernunft», die hier als Subjekt fungiert? Wieso – so lautet die Gretchenfrage – soll das, was sie (wer?) als «notwendig» einsieht, faktisch normativ Kraft entfalten?
Reisst man den von Habermas identifizierten Schleier weg, ist es ein bisschen so wie mit des Kaisers neuen Kleidern. Man weiß nicht recht, worauf man sich eigentlich verlassen hat, wenn man sich auf die Vernunft und ihre moralische Kraft gegründet hat; im Bild gesprochen: was man meinte gesehen zu haben, wenn man im Konsens von der «Vernunft» gesprochen hat.
Will man nicht mit Kant untergehen, empfiehlt es sich, auf andere Meisterdenken wie Friedrich Nietzsche und Sigmund Freud zu hören. Sie entwerfen ein umfassenderes Bild vom Menschen, der sehr viel mehr und noch etwas ganz anderes ist als ein animal rationale.
4. Kants rationalistische Ethik-Begründung (2): Vermag Vernunftmoral die Gemeinschaft zu tragen?
Kants rationalistischer Ethik-Ansatz ist auch Thema in Habermas’ Überlegungen zur Rolle der Religion in seinem Konzept eines nachmetaphysischen Denkens. Letzteres vermag zwar, so Habermas, mit der Kraft rationaler Argumentation sowohl mit dem «Vernunftdefätismus» postmoderner Spielart als auch mit einem «wissenschaftsgläubigen Naturalismus» «alleine fertig [zu; hph] werden» (Ein Bewußtsein von dem, was fehlt, in: Ein Bewußtsein von dem, was fehlt. Eine Diskussion mit Jürgen Habermas, hg. von Michael Reder und Josef Schmidt, Frankfurt a.M. 2008 (es; 2537), (26-36) 30). Die folgenden Angaben im Text beziehen sich auf diesen Aufsatz).
Aber «anders verhält es sich mit einer praktischen Vernunft, die ohne geschichtsphilosophischen Rückhalt an der motivierenden Kraft ihrer guten Gründe verzweifelt, weil die Tendenzen einer entgleisenden Modernisierung den Geboten der Gerechtigkeitsmoral weniger entgegenkommen als entgegenarbeiten.» (30)
Was Habermas verklausuliert anspricht, ist die Befürchtung eines zerbrechenden, für eine Gesellschaft zentralen ethischen Konsenses, nachdem die tragenden religiösen und metaphysischen Orientierungen immer mehr diffundieren und ihre normative Kraft einbüßen.
Die praktische Vernunft leistet zwar «Begründungen für die egalitär-universalistischen Begriffe von Moral und Recht, die die Freiheit des Einzelnen und die individuellen Beziehungen des einen zum anderen auf eine normative einsichtige Weise bestimmen.» (30)
D.h., von der Qualität der rationalen Argumentation her sind die Vorgaben der praktischen Vernunft ohne Tadel. Habermas sieht hier aber – analog zu den Überlegungen zum «ewigen Frieden» ein ganz anderes Problem: «Aber der Entschluß zum solidarischen Handeln im Anblick von Gefahren, die nur durch kollektive Anstrengungen gebannt werden können, ist nicht nur eine Frage der Einsicht.» (30)
Es geht bei der Motivation und bei der praktischen Umsetzung des theoretisch als richtig Eingesehenen nicht nur um rationale Schlüssigkeit und Nachvollziehbarkeit.
Kant habe «diese Schwäche der Vernunftmoral durch die Ermutigungen der Religionsphilosophie wettmachen wollen» (30), aber eben wegen derselben von ihm vertretenen «spröden Vernunftmoral» die Verbindlichkeit eben dieser religiösen Überlieferungen und Überzeugungen auch entscheidend geschwächt.
Im Ergebnis, so resümiert Habermas, «verfehlt die praktische Vernunft ihre eigene Bestimmung, wenn sie nicht mehr die Kraft hat, in profanen Gemütern ein Bewußtsein für die weltweit verletzte Solidarität, ein Bewußtsein von dem, was fehlt, von dem, was zum Himmel schreit, zu wecken und wachzuhalten.» (30f)
Unabhängig von der Frage, ob Religion sich hier erneut verzwecken lassen sollte, diagnostiziert Habermas hier und an anderen Orten:
Die praktische, auf Kants Modell gegründete Vernunft kann allein nicht stehen.
Sie vermag zwar vernünftige Begründungen für eine Vernunftmoral, für den kategorischen Imperativ und die daraus abzuleitenden Maximen zu liefern.
Aber diese praktische Vernunft greift zu kurz. Ihr fehlt auf sich selbst gestellt erkennbar die Kraft, das, was vernünftig ist, auch zu realisieren.
Der Grund für diese «Schwäche der Vernunftmoral» ist eben, dass sie allein auf Rationalität setzt und dass in ihrem allein durch den Vernunftbegriff Kants und seine Ableitung bestimmten Rahmen Gott allenfalls als regulatives Prinzip der Vernunft, als – rationales – Postulat, als Forderung vorkommt, was gedacht werden und empfunden werden müsste, damit Menschen sittlich-moralisch handeln. Noch einmal ist geltend zu machen:
Der Mensch ist mehr und ganz sicher anderes als ein sich autonom selbst bestimmen könnendes, vernünftiges Wesen. Das Projekt einer sich selbst begründenden, geschlossenen, auf sich selbst zurück gekrümmten und sich selbst genügenden Vernunft greift ein weiteres Mal zu kurz.